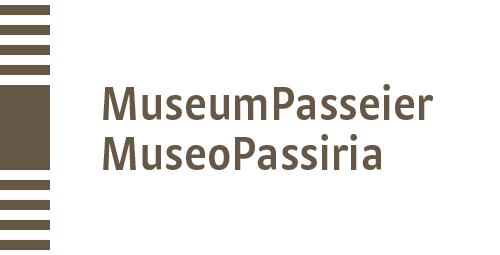Warum sammeln wir, was wir sammeln?
Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier
Gedanken zu museumsgereiftem Müll und einem fragenstellenden Schaudepot.
Von Judith Schwarz
Im Museum gibt es eine Geduldflasche. Also eine Flasche, in die Alltagsobjekte oder Miniaturszenen hineingesteckt worden sind. Stöpsel zu – gefangen – für später vakuumiert. Wäre es mit Museumsobjekten doch auch so einfach!
Sammeln ist, eine Flaschenpost in Richtung Nachwelt verschicken. Diesen Satz haben schon viele Museumsdirektor*innen zitiert. Ich wollte den abgewetzten Spruch mit einem Foto unserer Geduldflasche kombinieren. Und damit bequem zu einem mittelmäßigen Titelblatt für meinen Vortrag am Südtiroler Museumstag 2018 kommen. Einen Vortrag über „das Sammeln“ des MuseumPasseier, das als Best-Practice-Beispiel angekündigt werden sollte.
Nun denn, ich habe die Geduldflasche nicht gefunden. Das sagt natürlich einiges aus über unsere professionelle Sammlungsarbeit. Es gibt zu diesem Objekt nicht nur kein Foto. Auch der Eintrag unter „aktueller Standort“ ist alles andere als aktuell – sonst hätte ich die Geduldflasche ja schnell holen und fotografieren können. Damit blieb nur noch die systematische Suche in unserem tadellos aufgeräumten Museumsdepot. Irgendwann endete mein Geduldfaden. Und damit auch die vage Hoffnung, dass unsere Sammelpraxis als Erfolgsrezept überzeugen könnte.
Also zum Thema: Warum sammeln wir, was wir sammeln? Gemeint ist nicht, warum der Mensch im Allgemeinen sammelt, mit Vorliebe Dinge aus alter Zeit. Sondern: Warum sammelt das MuseumPasseier, was es sammelt? Wenn man es knapp zusammenfassen will, haben wir drei Sammlungen.
Eine Sammlung zu Andreas Hofer. Knapp 100 Andreas-Hofer-Objekte, die wir als MuseumPasseier übernommen haben vom ehemaligen Andreas-Hofer-Gedenkraum am Sandhof. Zuzüglich etwa 500 Andreas-Hofer-Objekte, die wir seit Bestehen des MuseumPasseier gezielt angekauft haben. Sieht man von einigen wenigen Hoferkitsch- und Hoferkommerzartikeln ab, die wir jährlich aufstöbern, sehen wir – vor allem aus Budgetgründen – die Sammlung als so gut wie komplettiert an.
Die Sammlung zum Thema Held*innen der heutigen Zeit. Die benötigen wir für unsere Dauerausstellung „Helden & Wir“, die wir 2013 eröffnet haben und in der es um heutige Vorbilder, Stars und Held*innen geht. Hier konnten wir auf keinen Grundstock zurückgreifen und beschlossen, gezielt zu sammeln. Konkret heißt das: Wir möchten gezielt sammeln, es gelingt uns aber nicht bzw. nur bedingt: Wir schreiben heutige Held*innen, Stars Vorbilder an und bitten sie um Leihgaben oder Schenkungen: Es braucht viel Hartnäckigkeit und vor allem gute Kontakte, am besten beides, um hier Zusagen zu erhalten. Diese Sammlung wächst sehr, sehr langsam: Ein bis zwei Objekte pro Jahr.
Und dann ist da noch unsere Volkskundesammlung. Ein Altbestand an rund 600 Objekten, gesammelt seit den 70er Jahren von Mitgliedern des ehemaligen Heimatmuseums in St. Martin in Passeier, von welchem wir die Bestände übernommen haben. Und die in den knapp 20 Jahren seit Bestehen des MuseumPasseier um nochmal zirka 1.000 Objekte angewachsen ist.
Man kann es auch so sagen: Wir haben nicht gesammelt. Es hat sich gesammelt.
Eine Pensionistin will ihre Heiligenbilder und Wallfahrtandenken dem Museum vermachen, denn ihre Enkelkinder haben kein Interesse und etwas Geweihtes darf man nicht wegwerfen. Und das Museum hat ihr natürlich den Gefallen getan.
Ein Jungbauer hat den Hof und damit auch eine Entscheidung geerbt: Soll er beim Umbau oder Neubau den alten Krempel in Dachboden, Keller und Stadel aufbewahren oder wegwerfen? Und er reicht die Entscheidung ans Museum weiter – mit einem gewissen drohenden Unterton: Wenn ihr es nicht nehmt, „når håkk i s zåmm“ (wird es Brennholz). Und das Museum hat den Krempel natürlich vor dem Feuer gerettet.
Am Morgen, wenn die Museumsmitarbeiter*innen ihre Arbeit beginnen, finden sie vor der Museumstür eine Kiste mit Werkzeug und alten Arbeitsgeräten. Offenbar hat sich ein guter Mensch eine gute Tat erlaubt. Und das Museum hat natürlich die Findelkinder übernommen.
Wer hat es bemerkt? Wir haben ein großes Herz. Und kein Sammelkonzept. Vielleicht ist es die Emotionalität, die Volkskundeobjekten – möglicherweise mehr als Hofer-Devotionalien – anhaftet? Vielleicht ist es der Eindruck der Unbegrenztheit bei Volkskundeobjekten, während Hofer-Reliquien – Gott sei Dank – begrenzt sind? Auf alle Fälle hat es aber mit der Botschaft zu tun, die wir als Museum vermitteln: Bringt uns, was euch wichtig ist – das Museum sammelt es!
Dann haben wir unsere Volkskunde-Ausstellung neu ausgerichtet. Bis 2015 war sie eine klassische Volkskundeausstellung, wie sie in den meisten alpenländischen Tal- oder Heimatmuseen zu finden ist. Ihr Verdienst bestand darin, dass sie viele Alltagsobjekte, die vor dem Verschwinden gerettet worden waren, ausgestellt hat.
Nun bekam die Volkskundeabteilung ein neues Überthema. Zum Ausgangspunkt wurden die Psairerinnen und Psairer selbst. Hierfür konnten wir auf etliche Objekte aus unserer Sammlung zurückgreifen. Einen Teil aber haben wir neu gesammelt bzw. neu sammeln müssen.
Die Ausstellung fragt (natürlich mit einem Augenzwinkern): Was macht den Psairer zum Psairer? Von außen gesehen ist es die Passeirer Tracht. Einerseits ein klassisches Objekt für eine Volkskundeausstellung, fast ein Pflichtobjekt. Auf der anderen Seite identifizieren sich heute nur sehr wenige Passeirer*innen über die Tracht. Verwenden aber gleichzeitig fleißig die Bilder der Schützen und Schildhofbauern in Tracht, z.B. für die Tourismuswerbung. Wie sollte also eine nur auf die Vergangenheit gerichtete Perspektive genügen? Auch an Objekten zur Volksfrömmigkeit besitzen wir natürlich die üblichen klassischen. Wie aktuell sind sie heute? Auf einer Passeirer Alm haben wir im Herrgottswinkel einträchtig zwischen Heiligenfiguren und Wallfahrtsandenken einen Buddha gefunden. Auch er gehört jetzt zu unserer Volkskundesammlung. Uns ist bewusst, dass wir damit nicht nur neue Objekte sammeln, sondern mit ihnen auch Bedeutungen aufheben. Das ist sehr fragmentarisch, auch zufällig, aber vielleicht gerade deswegen plausibel. Auf der anderen Seite – das ist das Dilemma – konstruieren wir diese besonderen Bedeutungen neu, indem wir sie im Museum präsentieren. Ein paar Beispiele:
Hoppe-Griff. 2013 wurde nach über 40 Jahren das Werk der Hoppe AG in St. Martin in Passeier geschlossen, eine Türklinge aus der letzten Passeirer Produktionsserie haben wir ins Museum gebracht.
Heuprofi. Im selben Jahr hat ein Passeirer Schmied einen Aufsatz erfunden, der aus Mähmaschinen Rechenmaschinen macht – er verkauft sie an Bauern aus ganz Südtirol, eine haben wir ergattert.
Fussball. 2014 hatte die Deutsche Nationalmannschaft ihr WM-Trainingslager in Passeier, über das Touriseum haben wir einen DFB-Fußball mit den Unterschriften der Elf bekommen.
Dreiradler. In Passeier gibt es eine Ape-Szene, vor allem Jugendliche tunen ihre Dreiradler – inzwischen hat es sich etwas gewandelt, mehr hin zu einer Vespa-Szene. Einen halben Dreiradler – eigentlich so nur mehr ein Einradler – haben wir in der Ausstellung an die Wand gehängt.
Eine Volkskundeausstellung, in der fast zur Hälfte zeitgenössische Stücke gezeigt werden? Davon zeigten sich die Besucher*innen durchwegs überrascht: Eine Volkskundeausstellung, bei der man nicht schon vor Betreten weiß, welche Objekte man zu sehen bekommen wird. Andererseits: Wie können wir – sagen wir – ernsthafte Volkskunde-Liebhaber*innen zufrieden stellen? Oder auch Menschen, die uns ihre Objekte geben, und sie dann nicht ausgestellt vorfinden?
Die Idee für ein Schaudepot entstand. Das Gebäude hatte bereits ein abgeteiltes Depot, das wir vor zehn Jahren angelegt hatten, weil unser eigentliches Depot zu klein geworden war. Die Betonwände, die Neonlampen, die Regale – es wurde so belassen wie es war. Nur ein bisschen mehr aufgeräumt haben wir. Es ist der Raum hinter der Volkskunde-Ausstellung, also die Sammlung steht hinter der Ausstellung. Man betritt die Ausstellung und sieht die schöne Präsentation, die Ausstellung, in der alles erklärt und aufbereitet ist.
Das Schaulager ist nur Backstage, die Rumpelkammer dahinter. Hier – scheint es – wurde nichts gemacht, außer Regale mit Objekten vollgestopft. Nicht jede*r mag nach der inszenierten Ausstellung weiter gehen, mag tiefer gehen. Andererseits ist es das Bild, das wir mit einem Lager verbinden: Die verborgenen Schätze hinter verschlossenen Türen. Besucher*innen haben nun Zutritt zu diesem Raum, auf dessen Tür normalerweise „Kein Zutritt“ stehen würde – und können stöbern, rätseln (wir haben die Objekte nicht beschriftet) und auch In-alten-Zeiten-schwelgen.
Es war nicht beabsichtigt: Das versteckte Schaudepot wurde zum Herzstück der Ausstellung. Und was man oft vergisst: Letztlich ist jedes Schaudepot genauso eine kuratierte Ausstellung. Der Zweck des Schaudepots ist es zwar, Depot zu sein. Zugleich zeigen wir aber auch unser Sammeln. Die Objekte werden sichtbar gemacht, aber auch unsere Sammelpraxis. Und damit waren wir nun an dem Punkt angelangt, an dem wir uns mit unserem (nicht vorhandenem) Sammelkonzept auseinandersetzen wollten und mussten.
Mit der Planung des Schaudepots haben wir unser Sammeln erstmals bewusst hinterfragt. Und diese Erkenntnisse – eigentlich sind es Fragen, die wir uns gestellt haben – haben wir den Besucher*innen nicht vorenthalten. Wir haben sie zum eigentlichen Thema des Schaudepots gemacht. Die Fragen tauchen im Schaudepot als einzige Beschriftungen auf, im Stil von Lageretiketten.
Weiß das Museum, was ihm fehlt? Das war eine erste wichtige Frage: Im Schaudepot steht sie in einem leeren Regal. Was haben unsere Vorgänger nicht gesammelt? Was vergessen wir zu sammeln – wollen wir nicht sammeln – können wir nicht sammeln? Ist uns bewusst, wie einseitig und lückenhaft unser Bild von der Vergangenheit ist? Lückenhaft, weil sich nicht alles gleich gut sammeln ließ oder lässt. Weswegen wir viele Objekte aus Eisen und Holz haben, aber wenige Objekte aus Glas oder Stoff.
Sollte man ein Depot nicht größer planen? Oft scheitert der Sammelwille an banalen Dingen, wie beispielsweise der Depotgröße: Eine Sammlung von 100 Hosenknöpfen oder eine Sammlung von 100 Kleiderschränken unterzubringen, ist ein Unterschied. In unserem Schaudepot steht das Kärtchen mit dieser Frage auf einem Schrein, dahinter eine gotische Stubenwand, die das Museum beim Abriss eines alten Bauernhauses erhalten hat. Wo sollten wir weitere Wände oder Schreine unterbringen? Gar nicht, wir haben keinen Platz.
Warum nur Holzrechen, und keine Plastikrechen? Die Einseitigkeit unserer Sammlung wurde uns auch anhand anderer Bereiche bewusst. Warum haben wir sieben Nähmaschinen, aber keine Mähmaschine? Warum sammeln wir zig Holzrechen, aber keine Plastikrechen? Wer hatte ein Faible für Spannsägen, so dass wir heute 32 Spannsägen besitzen? In unserem Fall haben wir uns die „Ehrfurcht“ vor dem Sammelkonzept unserer Vorgänger zunutze gemacht, sprich: die Tatsache, dass wir nicht „entsammeln“ wollen: Wir stellen die 32 Spannsägen im Schaudepot aus mit den Fragen: So viele? Genügte nicht eine?
Wer bestimmt überhaupt, was gesammelt wird? Interessanterweise eine Frage, die sich Besucher*innen selten stellen. Dazu präsentieren wir in einer ausgeleuchteten Vitrine im Zentrum des Schaudepots ein beliebiges, nicht besonders altes oder kostbares oder seltenes oder symbolträchtiges Objekt. Daneben, in einer Art Wühlkiste, liegen weitere solche Objekte, ungeschützt.
Wer hat entschieden, welches Objekt ausgestellt wird? Welches einen Ehrenplatz in einer Ausstellung erhält und welches im Lager verschwindet? Wer bestimmt überhaupt was ein Museumsobjekt ist? Wer wählt diesen Bruchteil von dem, was einmal im Gebrauch war und im Museum Platz findet aus – und entscheidet über den Rest: den Müll?
Was ist der Unterschied zwischen Müll und Museumsobjekt? Die Dinge, die wir heute benutzen oder wegwerfen, sind ja nicht in einer Zeitkapsel, sind nicht eingefroren und warten, bis sie von Museumsleuten später aufgetaut werden. Es ist umgekehrt. Erst in dem Moment, wenn sie ins Museum kommen, bleibt die Zeit stehen, wird ihnen keine Funktion, kein Gebrauch und keine Weiterentwicklung bis zum Vergehen mehr zugemutet. Erst jetzt frieren wir die Geschichte ein, um sie der Nachwelt erhalten zu können.
Wir haben Passeirer Müll aus dem Jahr 2005 im Museum „eingefroren“. Und ihm Passeirer Müll aus dem Jahr 2015 gegenübergestellt. Wie traditionell ist der Psairer Müll? Unterscheidet er sich vom Müll anderer Täler? Nein, oder? Und doch müssen wir uns eine weitere Frage stellen.
Was ist vom heutigen Psairer Müll morgen museumsreif? Alles können wir nicht sammeln, das ist klar. Jemand muss die schwierige Aufgabe übernehmen, den Müll zu filtern. Auswählen, interpretieren und damit historische Überlieferung gestalten. Wobei wir wieder beim genannten Dilemma wären. Übrigens: In diesen Regalen geben Besucher*innen gerne auch ihren Müll ab – das ist nicht beabsichtigt, aber nett. Zum Beispiel eine Fahrkarte der Hirzer-Seilbahn. Wer weiß, ob die mal ein wichtiges Zeitdokument wird?
Noch etwas zum Thema Müll: Beim Durchstöbern unseres Museumslagers haben wir einige neue Ausstellungsstücke gefunden, die wir längst gesammelt hatten, ohne es zu bemerken: Zum Beispiel den Karton, in dem die alten Objektbeschriftungen des ehemaligen Heimatmuseums aufbewahrt wurden. Eigentlich wären sie Müll, so wie man gelaufene Ausstellungen abbaut und entsorgt.
Jemand hat mal gesagt, sammeln hat auch mit Vergessen zu tun. Hier ist es wörtlich zu verstehen. Wir haben die alten Objektbeschriftungen nicht gesammelt, wir haben sie einfach nicht entsorgt. Und dann vergessen. Heute ist der Karton, so wie er 1995 in unserem Lager untergetaucht ist, im Schaudepot ausgestellt. Und da wir im Schaudepot bewusst keine Objekte beschriftet haben, macht der Karton mit den alten Objektbeschriftungen unter anderem auch das zum Thema. Objektbeschriftungen: Sind sie Hilfe, Pflichtübung oder Fantasiekiller?
Keine Ahnung, was das ist. Dieses Schild zeigt nicht nur, dass auch (gerade?) ein Museum nicht alles weiß. Es zeigt, dass ein Objekt auch den umgekehrten Weg gehen kann: Ein Museum sammelt einen Gegenstand und gibt ihm eine Bedeutung – und einige Jahrzehnte und Museumsdirektor*innen später, wird aus dem Museumsobjekt wieder ein Gegenstand, dessen Bedeutung man nicht kennt.
Wir sollten also nicht aufhören, Fragen an jene Dinge zu stellen, die uns im Alltag umgeben: Vielleicht ist das nächste tolle Museumsobjekt darunter. Und wir sollten nicht aufhören, Fragen an unsere bereits gesammelten Objekte zu stellen – die wir oder unsere Vorgänger*innen – warum auch immer – ins Museum gestellt haben.
Diesen Text hat Judith Schwarz ursprünglich im Rahmen des Südtiroler Museumstages am 12.11.2018 im Noi Techpark in Bozen vorgetragen. Für diesen Blogbeitrag hat sie ihn etwas verändert.