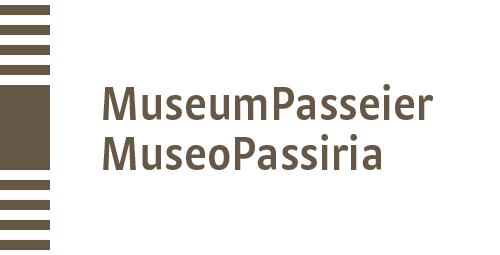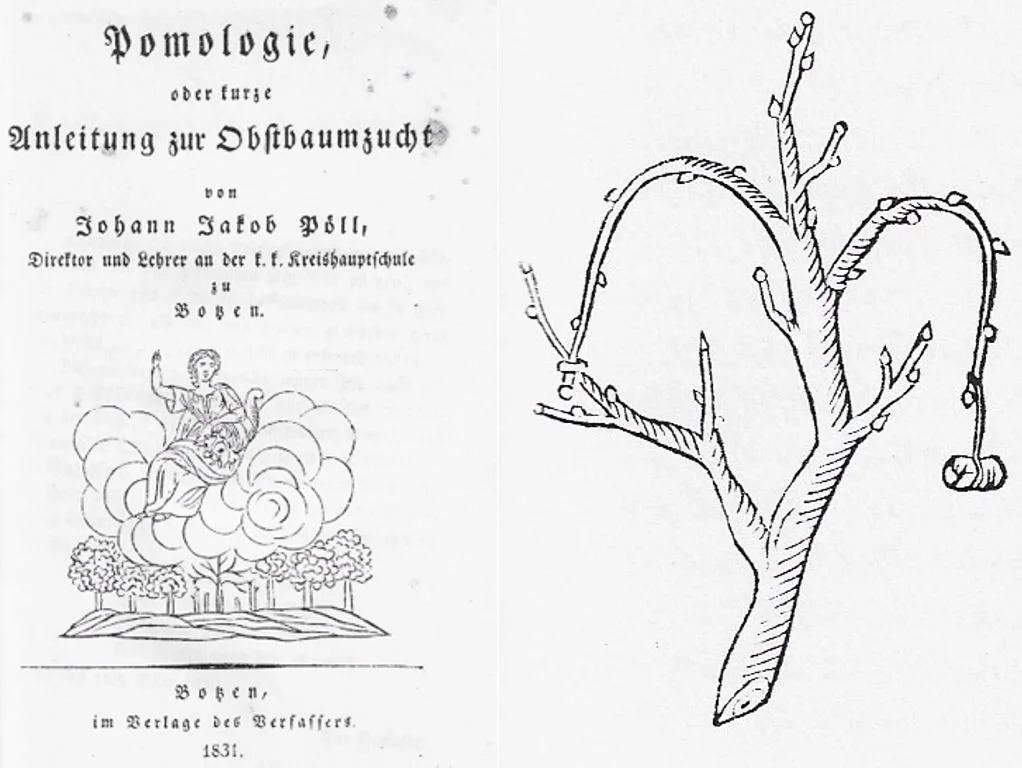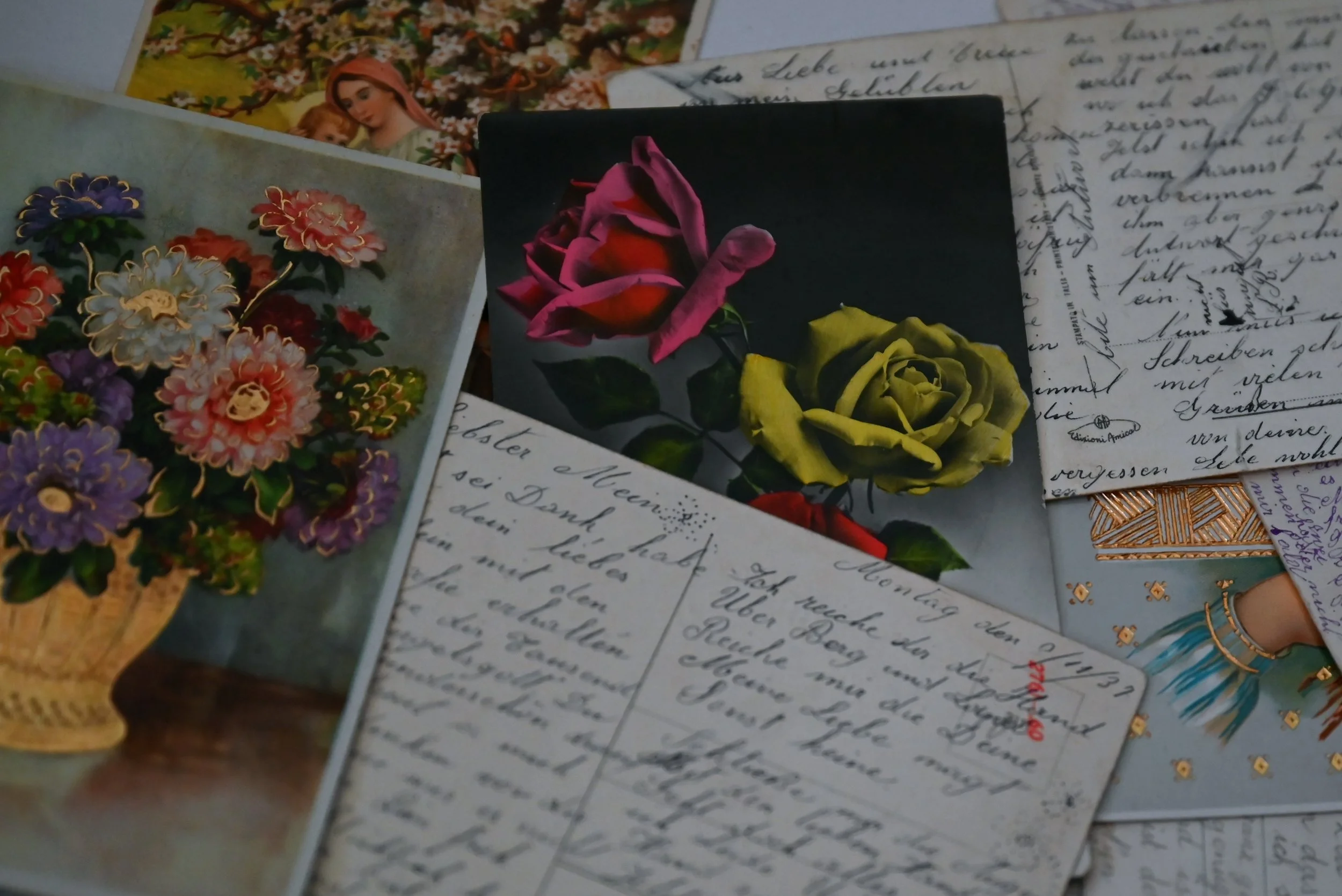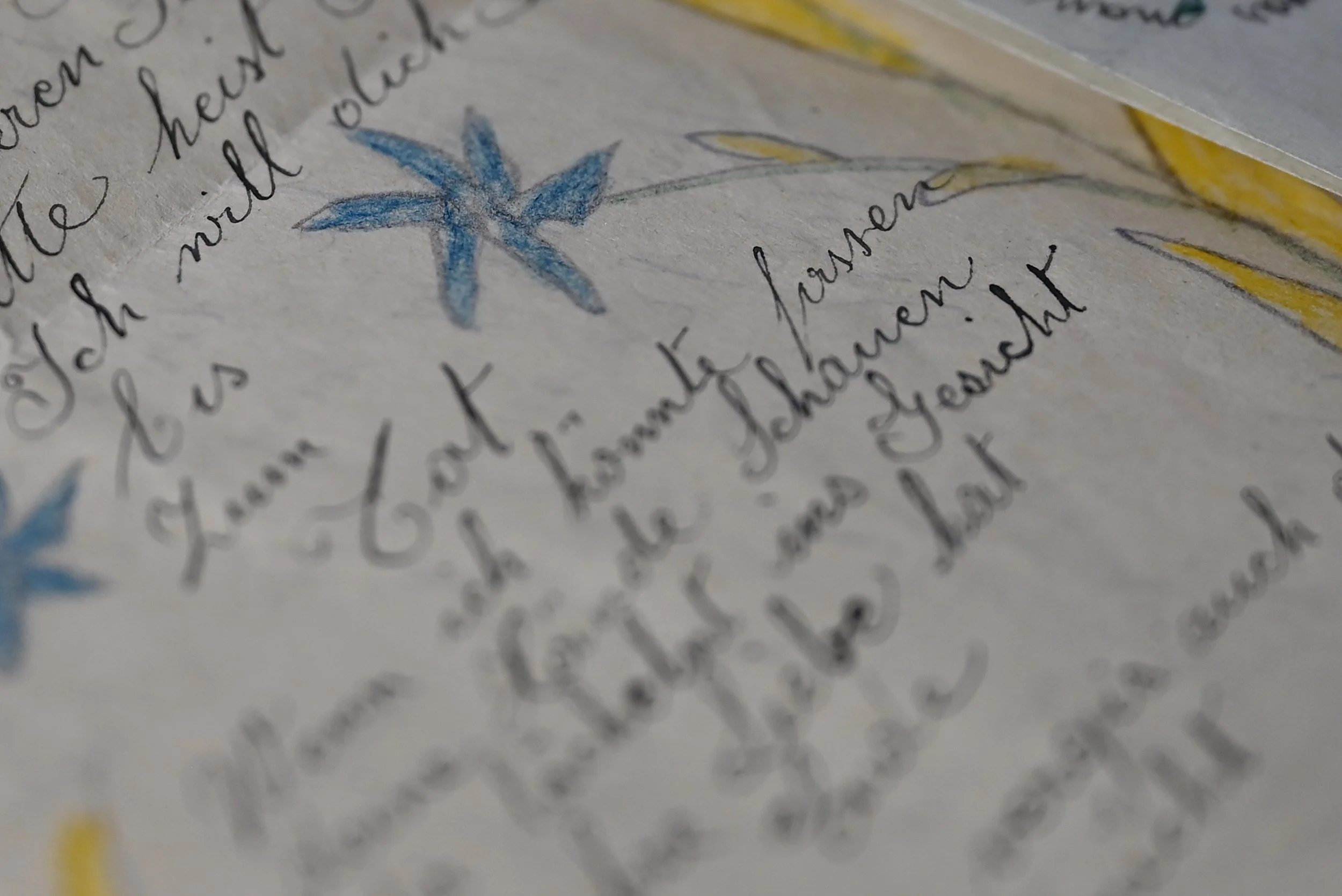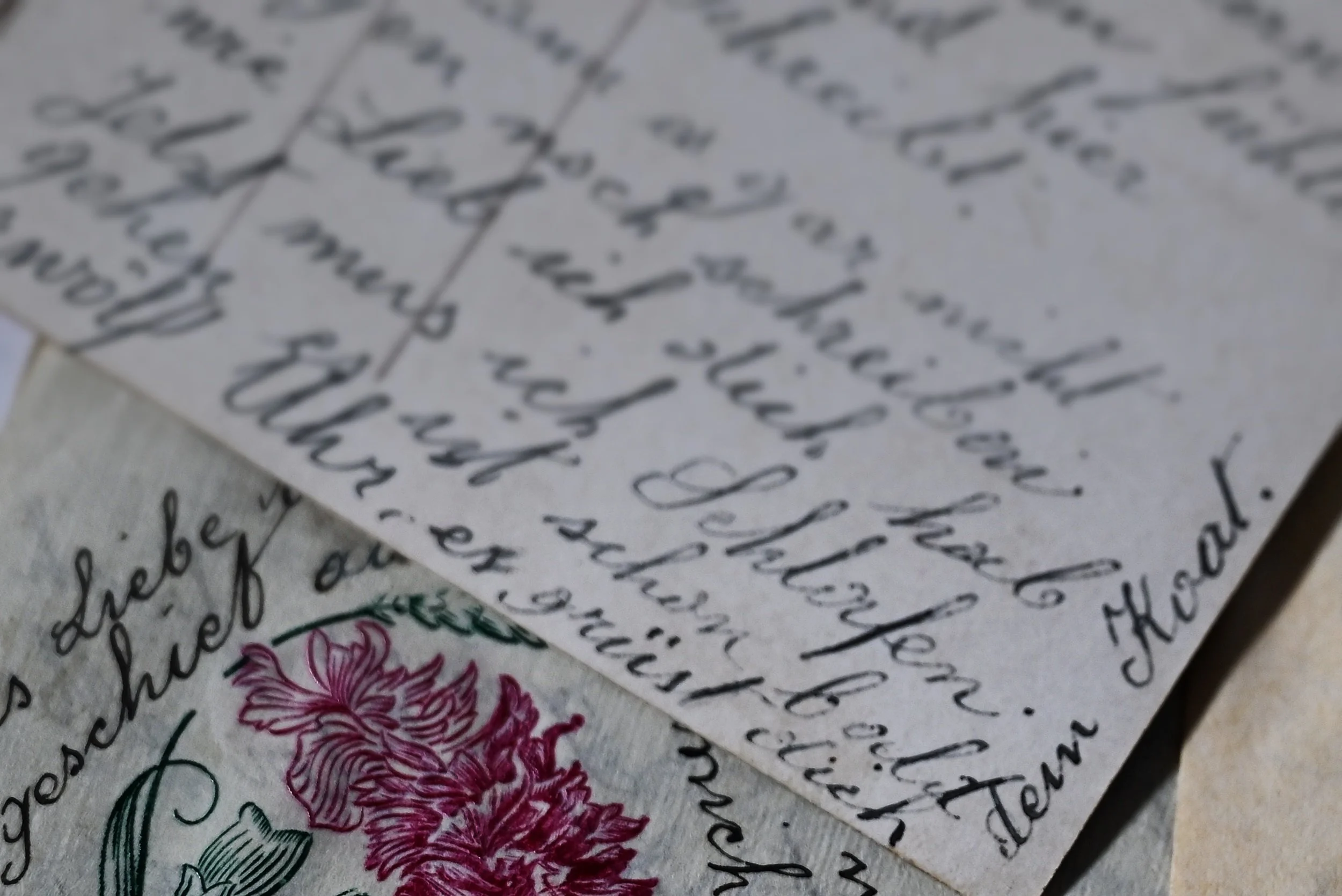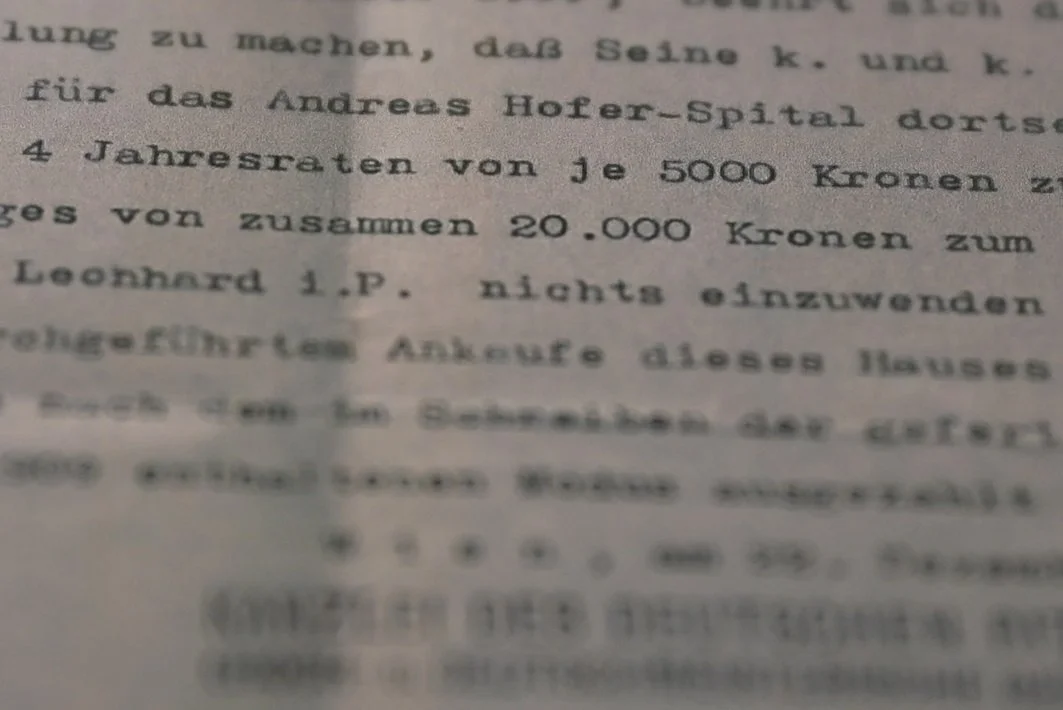Unser Blog
-
Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.
-
Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.
-
Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.
-
Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.
Eine Ausstellung treibt Blüten
Alte Meister in Passeier als Inspiration für die Meisterausbildung zur Floristin.
Florales Kunstwerk, das “Uffizi in Passeier” zum Thema hat.
Alte Meister in Passeier als Inspiration für die Meisterausbildung zur Floristin.
Text und Fotos: Sophia Egger
Am Anfang einer jeden Gestaltung steht die Idee. Die Idee hinter meiner Arbeit im Rahmen der Meisterausbildung zur Floristin an der Akademie für Naturgestaltung in Niederösterreich findet ihren Ursprung in den Uffizien in Florenz. Meine Aufgabe war es nämlich, zu den weltbekannten Kunstgalerien in der Toskana eine florale Gefäßfüllung zu gestalten. Zu einer Gefäßfüllung gehört zum einen das passende Gefäß und zum anderen, wie das Wort schon erahnen lässt, die entsprechende florale Füllung dazu.
Da das Thema Uffizien sehr breit gefächert ist, galt es, das Thema einzugrenzen. Beispielsweise auf einen bestimmten Künstler, auf ein bestimmtes Bild oder auch auf einen bestimmten Auftraggeber. Nach längerem Recherchieren und einigen Gesprächen war mir dann aber bald das eigentliche Thema meiner Gefäßfüllung klar. So stehen die Uffizien nämlich in enger Verbindung zu Südtirol. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges lagerten viele Bilder aus den Uffizien im Passeiertal, genauer gesagt in St. Leonhard, um sie vor den Bombardements in den Städten zu schützen. Zu diesem Thema gab es auch eine Sonderausstellung im MuseumPasseier, die den Titel „Uffizi in Passeier“ trug. Genau dieser Titel sollte nun Thema meiner praktischen Hausaufgabe werden.
Sophia Egger hat sich für ihre Themenarbeit “Uffizi in Passeier” viel Hintergrundwissen angeeignet und freut sich über den Blogartikel, denn so wird unser Beruf auch in einem anderen Kontext sichtbar, so wie wir es auch in unserer Ausbildung lernen, dass unser Beruf weit über das hinausgeht, was die meisten Menschen sich darunter vorstellen.
Es spielte sich nämlich folgendes ab: Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges befürchtete man in Italien einen Luftkrieg. Aus diesem Grund leerte Italien seine Museen und die Kunstschätze von Florenz wurden in Kirchen, Schlössern und Villen der Umgebung gebunkert. Als der Krieg im Sommer 1944 dann Florenz erreichte, räumte der Deutsche Kunstschutz (eine Abteilung der Deutschen Wehrmacht) die Depots und fuhr die Kunstschätze nach Norden. An die 300 Bilder landeten im verlassenen Gerichtsgebäude von St. Leonhard in Passeier, darunter Gemälde von Botticelli, Caravaggio, Rubens, Tizian und Cranach.
Da die Evakuierung schnell vonstattengehen musste, wurden die Bilder nicht sehr sanft transportiert. Sie wurden auf den LKWs zwischen Stroh und Wolldecken gelagert. Einige von den Bildern wiesen nach dem Transport Risse oder auch Schimmelflecken auf. Ob das Lager in Südtirol als Zwischenspeicher eines organisierten Kunstraubes verwendet wurde oder ob es sich um reine Rettungsmaßnahmen handelte, wird von Kunsthistorikern bis heute kontrovers diskutiert.
Meine Aufgabe war es nicht, ein Urteil über dieses Ereignis abzugeben. Meine Aufgabe bestand darin, dieses Ereignis in einer Gefäßfüllung floral zu interpretieren. In dieser Interpretation begrenzte ich mich ausschließlich auf den Transport der Kunstwerke aus Florenz ins Passeiertal in Südtirol.
Meine Idee basiert vor allem auf dem Material, in welchem die Bilder gehüllt waren. Stroh war zusammen mit Wolldecken und Backpapier jenes Material, das den Bildern auf ihrem langen Weg nach Südtirol Schutz bot. So entstand die Idee, ein Gefäß aus Stroh zu gestalten, das den Blumen, die sich in ihm befinden, Schutz bietet. Um in meinem Gefäß auch das Thema der wertvollen Kunstwerke, die sich zwischen diesem Stroh verbargen, zu verdeutlichen, kam die Idee, Bilderrahmen in meine Gefäßgestaltung mit aufzunehmen.
Ein Kubus aus Stroh sollte entstehen. Auf diesem Kubus sollten sich Bilderrahmen aus Stroh aneinanderreihen und zwischen diesen Bilderrahmen sollten sich die Blumen ranken. Nun galt es, die Idee in die Praxis umzusetzen. Dafür benötigte ich zu aller erst Bilderrahmen und einen Unterbau aus Styrodur-Platten für meinen Kubus aus Stroh. Die viereckigen Bilderrahmen habe ich in ein Gemisch aus Stroh und Holzleim eingehüllt und am Kubus befestigt. In den Kubus habe ich mehrere Löcher für schmale Glasröhrchen gebohrt, in welchen die Blumen mit Wasser versorgt werden können. Diesen entstandenen Kubus habe ich anschließend komplett in Stroh eingehüllt. So entstand der Eindruck eines Strohballens.
Damit eine Gefäßfüllung zu einer Gefäßfüllung wird, fehlte noch die Füllung. Dabei war es mir wichtig, dass sich die Blumen zwischen den Bilderrahmen rankten und das Stroh und die Rahmen einen Schutzmantel um die Blüten bildeten. Außerdem wollte ich einheimische Blumen mit exotischen Blüten mischen. Die in Passeier versteckten Bilder stammen so ziemlich alle aus der Zeit der Renaissance, in welcher viele Entdeckungen gemacht wurden. Mit den Entdeckungen neuer unbekannter Länder kamen auch exotische Pflanzen nach Europa.
Aber auch die Uffizien-Kunstwerke waren etwas Exotisches in St. Leonhard. Man vermutete nicht wirklich, dass Kunstwerke von so hohem Wert in einem alten Gerichtsgebäude lagerten. Genauso wenig wie man sich solches Weltkulturerbe zwischen Stroh gebettet auf LKWs vorstellen kann. So stehen die exotischen Blumen gemischt mit einheimischen Blüten symbolisch für die Kunstwerke, welche auf den LKWs zwischen gewöhnlichem Stroh transportiert wurden.
Das Wertvolle versteckt zwischen dem Gewöhnlichen. Zwischen dem, das eigentlich im totalen Gegensatz zum großen Wert der Bilder steht. Aus dem Strohkubus wachsen die wertvollen Blüten empor und ranken sich durch die mit Stroh überzogenen Bilderrahmen. So wurde aus einer Idee eine Gestaltung.
Möchtest du mehr über die Uffizi-Kunstwerke lesen, die 1944/45 in Passeier versteckt waren?
Und Fotos von den Gemälden zwischen Strohballen sehen?
Hier findest du unsere Blogartikel dazu:
Blog | Uffizi in Passeier
Uffizi in Passeier
Die Sonderausstellung widmet sich einer unglaublichen, aber dennoch fast vergessenen Geschichte, die zu ihrer Zeit die Deutsche Wehrmacht, Mussolinis faschistische Behörden und die US-Army mehr als bewegte. Es geht um Gemälde von unschätzbarem Wert, die während des Zweiten Weltkrieges in St. Leonhard in Passeier gelagert waren.
Wer schützt Kunst im Krieg?
Menschen ziehen in den Weltkrieg, um Kunst zu schützen? Das scheint abwegig und notwendig zugleich. Ein Blick auf die Sonderausstellung, die davon erzählt, wie 293 Kunstwerken aus Florenz nach Passeier und abwechselnd in die Hände zweier Kunstschutz-Einheiten gelangt sind.
Der verschollene Fotograf
Ein mysteriöser Passeirer namens Franz Ploner.
Franz Ploner: Ein mysteriöser großer Mann, den man wahrscheinlich längst vergessen hat und doch ist er mit seinen Fotografien präsent. Ausschnitt aus einem Studiofoto mit Franz Ploner. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Ein mysteriöser Passeirer namens Franz Ploner.
Text und Fotokolorierung: Tobias Egger-Karlegger
Wie es der Zufall so will. Im Sommer letzten Jahres geriet ich an das Bilderarchiv der Familie Ploner, welches ich von einem Familienmitglied im Vertrauen erhielt, um die Fotos ein wenig zu sortieren und zu digitalisieren. Da es sich um zahlreiche Fotos und Postkarten handelte, zog sich die Arbeit über das Jahr hin und eigentlich wollte ich die Fotos schon wieder zurückgeben. Doch immer wieder fiel mir ein markantes Gesicht auf. Als ich die Fotos etwas sortierte, fand ich plötzlich den Namen heraus: Franz Ploner: Obst, Gemüse, Südfrüchte, Landesprodukte u. Kurzwaren steht auf einem Schild. Direkt darunter zu sehen ist wieder dieser große Mann wie auf dem Präsentierteller – unverkennbar.
Das wahrscheinlich zufällig aufgenommene Foto vom Geschäft beim Gasthof zum Strobl in St. Leonhard in Passeier um 1920 (vgl. Ansichtskarte von 1918), zeigt Franz, wie er das Geschehen vor seinem Laden beobachtet. Ein LKW (Modell Mannesmann-Mulag) mitten im Dorf war sicher eine Seltenheit zu dieser Zeit. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Seine Fotos in Chronik- und Geschichtsbüchern aus unserem Tal. Versteckt in den Bildverzeichnissen fand ich in verschiedenen Büchern seinen Namen, vor allem bei Bildern aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ich stellte mir immer wieder die Frage: Wer war dieser Franz? Warum ist er auf so vielen Fotos zu sehen und warum gibt es nur Bilder von ihm in jungen Jahren?
Laut Fotos und Postkarten war Franz schon zu Kriegsbeginn 1914 beim 2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger. Der letzte Brief an die Eltern ist von 1918. Daher ist davon auszugehen, dass er bis Kriegsende im Wehrdienst war und somit fast vier Jahre im Krieg.
In der Mitte Franz Ploner im Jahr 1914, die beiden anderen Männer sind unbekannt. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Eine Postkarte an die Eltern vom 28. Februar 1918 zeigt Franz Ploner (links) auf dem zugefrorenen Ossiacher See in Kärnten. Er schreibt im Brief beste Genesungswünsche an den Vater und bittet um Rückantwort, damit er einen Fronturlaub antreten kann, um den kranken Vater zu besuchen. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Das Fotoarchiv der Familie Ploner ist erstaunlich vollständig. Es gibt von fast jedem Familienmitglied Fotos von Kindes- bis ins hohe Alter bzw. auch Sterbebilder. Auf Nachfrage bei den Nachkommen habe ich die Information bekommen, dass der Franz Fotograf gewesen sei, jedoch den Verbleib wisse man nicht genau. Er soll auch mit Schmugglerware hantiert haben.
Das Hochzeitsfoto der Eltern von 1891 in Rabenstein. Der Vater Thomas war 15 Jahre älter als die Mutter Theresia. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Vier Schneeberger Knappen um 1900, ganz rechts der Vater Thomas. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Wurzeln in Rabenstein. Da mir bekannt war, dass sein Vater Thomas Ploner ein Bergknappe bzw. Grubenaufseher am Schneeberg war, habe ich die Taufbücher der damals noch eigenständigen Gemeinde Rabenstein durchgenommen. Und siehe da, gefunden! Franz Thomas Ploner geboren am 26. Mai 1894 in Rabenstein, Sohn des Thomas Ploner (geboren am 2. Dezember 1853 in Villanders, gestorben am 15. September 1919 in St. Leonhard) und der Theresia Pfitscher (geboren am 23. Oktober 1868 in Rabenstein und gestorben am 21. Juni 1950 in St. Leonhard).
Der Eintrag zur Taufe von Franz Thomas Ploner im Taufbuch von Rabenstein.
Das Todesdatum von Franz Ploner fehlt im Taufbuch. Auch notierte der Pfarrer nachträglich folgenden Passus: hat die verlorene italienische Staatsbürgerschaft auf Grund des Art. 11 Gesetzesdekret Nr. 23 vom 2.2.1948, wie aus der diesbezüglichen Mitteilung der Präfektur von Bozen Optionen-Revisionsamt hervorgeht, wiedererlangt. Das bedeutet im Normalfall, dass jemand die Staatszugehörigkeit zu Italien durch die „Option“ im Zweiten Weltkrieg verloren hat und sie durch den entsprechenden Antrag wieder zurückerlangte. Also könnte Franz das Land verlassen haben und nach dem Krieg wieder zurückgekehrt sein.
Familientragödie. Aufgrund mehrerer Familienfotos, reizte es mich, etwas über die Geschwister herauszufinden, um so vielleicht eine Verbindung zu Franz herstellen zu können. Besonders tragisch dabei ist der Tod der ältesten Schwester Maria, die im Hungerjahr 1918 im Alter von 20 Jahren an einer Lungenentzündung (wahrscheinlich der Spanischen Grippe) starb. Zuvor waren bereits ein Bruder (Alois 1892–1893) und eine Schwester (Barbara 1908–1909) im Kleinkindalter nach nur wenigen Monaten verstorben. Laut Sterbebild trat der Vater im Jahre 1909 seine Rente an und kaufte laut Grundbuch im Jahr 1913 das Windeggerhaus in St. Leonhard. Die Familie lebte also von da an nicht mehr in Rabenstein.
Das Familienfoto wurde wahrscheinlich 1917 beim Windeggerhaus in St. Leonhard aufgenommen. Der Vater ist allem Anschein noch gesund und die älteste Tochter Maria lebt noch. Stehend v.l.n.r: Franz (geboren 1894, Todesdatum unbekannt), Anna (1902–1936), Maria (1898–1918), Sepp (1904–1969), Balbina (1906–1996). Sitzend v.l.n.r.: Thomas (1853–1919) und Theresia (1868–1950). Auf dem Foto fehlt der um zwei Jahre jüngere Bruder von Franz, Alois, später bekannt als Förster (1896–1973), der sich wahrscheinlich gerade im Krieg an der Front befindet. Foto: Familie Egger-Karlegger, nachträglich koloriert.
Das wohl „skurrilste“ Foto aus der Sammlung der Familie Ploner. Ob der Bub schläft? Der Katze ist es jedenfalls egal. Fotograf: Ploner Franz, Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Rückkehr aus dem Krieg. Nach vier Jahren Kriegszeit kamen Franz und sein Bruder Alois zurück in die Heimat. Es wird für sie sicher nicht einfach gewesen sein, wieder ein geregeltes Leben zu führen und in der Gesellschaft in St. Leonhard Fuß zu fassen. Hinzu kamen der plötzliche Tod der Schwester Maria im selben Jahr und nicht mal ein Jahr später auch noch der Tod des Vaters Thomas nach langer Krankheit, der vermutlich an einer Staublunge erkrankt war.
Das Foto zeigt die Familie Ploner zusammen mit der Familie der Mutter Theresia Pfitscher „Locher“ aus Rabenstein, vermutlich nach der Beerdigung des Vaters Thomas Ploner beim Tirolerhof im September 1919. Alle tragen schwarze Schürzen bzw. schwarze Kleidung, nur Franz präsentiert sich ganz elegant im weißen Anzug. Vorne in der Mitte sitzend die Großmutter Anna Pöhl Wwe. Pfitscher (1839–1922) zwischen ihren Töchtern. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Aktives Gesellschaftsleben bei den Umgestülpten. Es scheint, als hätte sich Franz doch ganz gut in der Dorfgemeinschaft von St. Leonhard zurechtgefunden. Zu sehen ist er allerdings nicht nur auf den Mannschaftsfotos der Feuerwehr, sondern sein Gesicht findet sich auch bei einem etwas schräg klingenden Verein namens Die Umgestülpten – Vince Luna wieder. Laut der Zeitung Volksbote vom 17.05.1923 wurde dieser Verein am Auffahrtstage 1898 vom Arzt Dr. Eduard Neurauter, genannt „Zeus“, gegründet. Es ist die ’Vince Luna’ oder Gesellschaft der ’Umgestülpten’, ein Verein, der fröhliche Geselligkeit mit Gesang und Gemütlichkeit pflegt, so liest man im Artikel. Die Mitglieder dieses Vereins waren allesamt im Dorf angesehene Bürger und Beamte mit Rang und Namen. Welche Aufnahmebedingungen dieser Verein hatte, geht nirgends hervor.
Dass der Franz Teil dieser Gruppe war, wundert nicht, denn die „Plonerer“ sind allgemein sehr gesellige Menschen, so sagt man. Jedenfalls steht fest, dass in der Stammtischgesellschaft gerne Ausflüge und gesellige Abende verbracht wurden, so beschreibt es auch Bergrevierinspektor Hans Wallnöfer (1881–1949) in seinen Erzählungen. Im Jahr 1928 wurde der Verein der Umgestülpten aufgelöst. Grund dafür könnten Unstimmigkeiten mit den italienischen Behörden gewesen sein.
Der Vince Luna Verein bei der 15 jährigen Gründungsfeier 1913. Da sich das Bild in der Sammlung der Familie Ploner befindet, ist anzunehmen, dass dieses Foto von Franz gemacht wurde. Zu sehen sind Persönlichkeiten des Tals, welche bereits vor dem Krieg im Militär aktiv sind. Die meisten von ihnen sollten sich ein Jahr später an der Front wiedersehen. Stehend v.l.n.r.: Pixner Luis – Teißwirt (1871–1941), Pfitscher Michael – Locher Much, Metzger (1877–1944), Hptm. Haller Leonhard – Egger, Prantach (1886–1948), Kofler Leonhard – Unterzögg (1880–1953), Delucca Eduard (1888–1953). Sitzend v.l.n.r.: Pixner Josef – Langer Neuner (1871–1957), Tschöll Vinzenz – Garber, Saltauserwirt (geboren 1876), Mader Vinzenz – Elektrotechniker (1868–1933) und Gstrein Vinzenz – Oberschramach (1855–1930). Fotograf vermutlich Franz Ploner, Fotobesitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Der Vince Luna Verein Mitte der 20er Jahre. Stehend hinten rechts Franz Ploner. Sitzend v.l.n.r.: Pirpamer Josef – Mader Peppi, Pixner Josef – Langer Neuner, Delucca Eduard und Kofler Leonhard. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Bei den „Steigern“ der Feuerwehr von St. Leonhard sieht man Franz hinten in der Mitte, als scheinbar größten Mann. Das Foto wurde 1921 vor dem Gasthof zum Strobl aufgenommen. Foto: Familie Egger-Karlegger, nachträglich koloriert.
Die letzten Fotos von und mit Franz. Im Bilderarchiv befinden sich nach dieser Zeit immer weniger Fotos, die auf den Fotografen Franz Ploner hindeuten. Eigentlich sollte er mit knapp 30 Jahren die Blütezeit seines Lebens erreicht haben, doch ich vermute, dass er nicht so gerne einer Arbeit nachgegangen ist, sondern sich lieber unter die Menschen mischte. Vielleicht hat er sich an kriminellen Machenschaften beteiligt, wie Schmuggel oder ähnlichem, was zu dieser Zeit durchaus üblich war, und musste deshalb untertauchen? Vielleicht hat er in seinem Laden nicht nur Südfrüchte und Kurzwaren verkauft, sondern auch Schmugglerware? Der letzte Hinweis, dass es sein Geschäft beim Strobl gab, ist ein Artikel im Volksbote vom 4. März 1920, in dem berichtet wird, dass in seinem Laden gewaltsam eingebrochen wurde und mehr als 500 Lire gestohlen wurden. Auch existiert eine Gewerbeliste von 1921, in der das Geschäft als Landesproduktenhandlung angeführt wird.
Auf dem Bild von Franz Ploner sind vier Samer, im Volksmund Kraxntrooger oder Schmuggler, zu sehen. War Franz vielleicht mit ihnen unterwegs? Fast sicher, sonst hätte er das Foto ja nicht machen können. Fotograf: Franz Ploner, Talarchiv Passeier, nachträglich koloriert.
Das Foto zeigt Franz Mitte der 1920er Jahre auf einer Kutsche talauswärts bei der Gerlosbrücke vor dem Reinstadlhof, den seine Schwägerin Theresia Egger 1925 erbt. Das Plonerhaus, wie es auch genannt wird, brennt 1956 vollkommen nieder. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Zwei Alpini-Soldaten mit Skiern in den Gåntëlln, die zwei anderen hinten müssen es wohl noch lernen – dem Hund gefällt es. Fotograf: Franz Ploner, Besitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Drei unbekannte Frauen beim Kaseregg und im Hintergrund ein Teil des Dorfes St. Leonhard Mitte der 1920er Jahre. Fotograf: Franz Ploner, Besitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Die Spuren verlieren sich. Neben ein paar Familienfotos Ende der 20er Jahre und Fotos mit einem Stempel mit dem Namen von Franz auf der Rückseite gibt es keine Spur mehr zu seinem Verbleib von ihm im Passeiertal. Im Jahr 1936 stirbt die Schwester Anna. Im selben Jahr wird der Name Ploner im Zuge der Italienisierung in Pioneri geändert, so geht es aus dem Eintrag des Bruders Alois im Taufbuch hervor. Dessen Sohn Albert (Neffe von Franz) wurde 1939 Mitglied der Faschistischen Jugend und erst 1944 wird der Name wieder in Ploner zurück geändert.
Vorne sitzend Franz Ploner mit einer unbekannten Gruppe von Personen, vermutlich Ende der 20er Jahre. Der Mann mit der Gitarre gehört zum italienischen Militär. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Das Foto zeigt Franz mit einem Mädchen. Es könnte sein Patenkind gewesen sein. Informationen dazu gibt es leider keine. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
In der Zwischenzeit muss sich Franz für die „Option“ ins Deutsche Reich auszuwandern entschieden haben. Wohin der Weg ihn geführt hat, ist nicht bekannt, ebenso wenig ob Franz wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Verwandte wissen zu berichten, dass Franz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Umgebung von Innsbruck gelebt haben soll. 1950 stirbt die Mutter. Fotos von der Beerdigung gibt es leider nicht. Mit dem Brand beim Reinstadlhof vulgo Plonerhaus sind wohl auch einige Fotos und Erinnerungen in Flammen aufgegangen.
Der letzte datierte Befund, dass sich Franz im Passeiertal aufhält, ist ein Schreiben des Inhabers des Gasthauses Leiteben (heute verlassen und verfallen) unterhalb der Jaufenalm von 1927, in dem es um eine Fotobestellung geht: Guter Freund! habe heute im meinem Schreibsachen alte Fotografien gefunden bräuchte des halb die bestellten nicht zu machen die Aufnahmen werde ich wergieten Mit Grus Plangger Cass. Leiteben. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Das vielleicht letzte Foto von Franz Ploner (links) vor dem Denkmal in St. Martin am Schneeberg. Jahr und Fotograf unbekannt. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.
Von Franz Ploner bleibt die Erinnerung an einen mysteriösen großen Mann, der mit seinen Fotografien doch nicht so einfach aus unserer Talgeschichte vergessen werden kann.
Die Geschichte sollte hier eigentlich noch nicht zu Ende sein.
Wer Hinweise zu Franz Ploner und seiner Familie hat, mag sie uns bitte weitergeben.
UPDATES:
7. Juni 2023: Franz Ploner ist in Innsbruck im Ostfriedhof im Stadtteil Pradl begraben. Als Todesdatum ist der 24. Jänner 1970 angegeben, sein Grab Nr. 66 befand sich in Grabfeld 61, es ist nicht mehr erhalten. In den Adressbüchern von Innsbruck findet sich 1964 und 1970 ein Franz Ploner als Pensionist mit Wohnsitz in der Dorfgasse 7.
Es war einmal ein Doktorhaus
Über eine Villa der Jahrhundertwende, die nicht mehr ist.
Das Doktorhaus in St. Leonhard in Passeier um 1930. Foto: Palais Mamming Museum.
Über eine Villa der Jahrhundertwende, die nicht mehr ist.
Text und Fotos: Manuel Thoma
Vier Jahrzehnte und einen Besitzerwechsel mit Renovierungsplänen später steht es nun vor dem Abriss, lese ich Anfang Jänner 2023 im Artikel Liegengebliebenes von Judith Schwarz in diesem Blog des MuseumPasseier. Die Rede ist vom sogenannten Doktorhaus, Ebnerhaus oder auch Neurauterhaus, einer alten Villa, die bis vor kurzem am unteren Ende der Kohlstatt in St. Leonhard in Passeier stand.
Für mich war es immer schon das „Neurauterhaus“, ohne jedoch irgendetwas Genaueres über dessen Geschichte oder den Namensgeber zu wissen. In meinen Erinnerungen war es nie bewohnt, es stand halt einfach da. Dann jedoch, im Wissen, dass es eben nicht mehr lange dastehen wird, entstand die Enttäuschung, niemals erfahren zu können, was es noch im Inneren beherbergte. Ich hatte nämlich schon immer diese kindliche Neugier, genau das wissen zu wollen. War es noch eingerichtet oder komplett leer? Wurde es irgendwann nochmal renoviert oder war alles noch so, wie vor 50, 60 Jahren? Gab es dort wirklich eine Turnhalle, wie es früher unter uns Kindern erzählt wurde?
Glücklicherweise bekam ich noch die Möglichkeit, mir das Haus anzusehen, sogar in Ruhe bis in die oberen Etagen spazieren zu können. Und nein, es gab dort keine Turnhalle, jedoch wunderbar hohe Räume mit alten Dielenböden, mehrere Kachelöfen, Möbel, teils im Stile der 50er, 60er Jahre, ein Stiegenhaus mit angenehm niedrigen Stufen und einem massiv gearbeiteten Holzgeländer… gute Handarbeit eben. Alles in einem Zustand, als wäre das Haus bis vor kurzem noch bewohnt gewesen. Dieser Besuch war der Auslöser, mich genauer mit der Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner*innen zu befassen.
Ich begann also meine Recherchen in Büchern und verschiedenen Online-Archiven. Meine Ausgangspunkte waren: Doktorhaus, Ebnerhaus, Neurauterhaus. Und ich hatte einen Namen:
Dr. Ed(uard) Neurauter
Doctorhaus, neu. So kurz und bündig beschreibt Josef Tarneller das Haus in seinem Werk über die Hofnamen im Burggrafenamt von 1909. Doch bereits 1895 fällt einem Zeitgenossen die rege Bautätigkeit in St. Leonhard auf und er bemerkt dazu Folgendes: Der Arzt Dr. Neurauter baut eine Villa in der Nähe des Bräuhauses, sowie auch in der Nähe des Gasthof Theis gebaut wird. Ebenso hat der neue Stroblwirth einen Stock aufgebaut.
Die Zeichen standen auf Aufbruch in jener Zeit. Die Talstraße von Meran bis St. Leonhard war gerade im Entstehen, nichtsdestotrotz hatte sich der Tourismus bereits Jahre vorher schon bis in die hintersten Ortschaften des Passeiertals ausgebreitet. Neue touristische Strukturen wurden gebaut, bestehende erweitert. Vor allem die Sommerfrischler*innen aus den Städten zog es in den Sommermonaten in die höhergelegenen Täler. Die Kurstadt Meran war gerade inmitten eines wirtschaftlichen und kulturellen Höhenflugs. Grandhotels und unzählige Villen entstanden in Meran, viele davon Bauten des Historismus und des Jugendstils. Vielleicht dienten sie als Vorbild für unser Doktorhaus?
Das Doktorhaus am 22.01.2023.
Das Doktorhaus war einzigartig für das Passeiertal, brachte es doch ein Stück städtisches Flair in ein Gebirgstal, welches zur Zeit der Erbauung noch nicht einmal über eine Straße nach Meran verfügte. Mit seinen verzierten Rundbögen und dem gusseisernen Geländer des überdachten Balkons, der Eingangstür mit kunstvoll gestaltetem Oberlicht oder dem mit Zinnen versehenen Turm war es immer schon anders als alle anderen Gebäude des Tales. Insofern dürfte das Haus bereits als Neubau die Aufmerksamkeit vieler Talbewohner*innen und Durchreisenden auf sich gezogen haben, führte doch der damalige Talweg direkt am Haus vorbei.
Oberlichte der Eingangstür des Doktorhauses.
Vom Doktorhaus tauchen nur sehr wenige detaillierte Fotoaufnahmen älteren Datums auf. Die erhaltenen Abbildungen zeigen jedoch, dass sich das Gebäude von 1895 bis Jänner 2023, also 128 Jahre lang, kaum verändert hat.
In den Zeitungsartikeln jener Zeit wurde das Haus nur sehr selten erwähnt, höchstens in nebensächlichen Bemerkungen. So zum Beispiel 1902 anlässlich des 25 Jahr-Jubiläums von Dr. Neurauter, als am Vorabend eine Lampionsbegleitung zum Doctorhaus, veranstaltet wurde, wo eine kleine Serenade stattfand und der Jubilar am nächsten Tag mittags von seinem schön geschmückten Wohnhause abgeholt und in feierlichem Zug zum Gasthof Theis geführt worden war. Eine weitere Erwähnung fand das Haus 1907 in einer Meuchelmordgeschichte, als der Wirt des Bräuhauses den betrunkenen Johann Plattner (ehemaliger Bauer auf dem Aignerhof) gegen das sogenannte Doktorhaus hin begleitete, in dessen Nähe Plattner kurze Zeit später von Josef Pixner, einem ledigen Knecht aus St. Martin, erschossen wurde. Nochmal kurz erwähnt wurde das Haus im Jahr 1919 in der Zeitung Der Tiroler: Die Villa Dr. Neurauter in St. Leonhard in Passeier ist durch Kauf um 12.000 Lire an die Gemeinde übergegangen. Über diesen Verkauf konnte ich jedoch keine weitere Dokumentation finden, auch ist im Grundbuch dazu nichts eingetragen worden.
Links das alte Bräuhaus, rechts das Doktorhaus, im Vordergrund ein Mann. Ansichtskarte um 1909 aus dem Archiv von Manuel Thoma, Fotograf Otto Mathaus.
Ganz anders verhält es sich bei seinem Erbauer Dr. Eduard Neurauter. Sein Leben kann durch Berichte in Zeitungen und Dokumenten über viele Stationen hinweg nachverfolgt werden. Wer war also dieser Mann, der kurz vor der Jahrhundertwende in einem kleinen, bäuerlichen Dorf eine Jugendstil-Villa errichten ließ?
Eine herzensgute Seele. Ein Artikel in der Ausgabe vom 24.02.1912 der Tiroler Stimmen berichtet vom Tod des Dr. Eduard Neurauter, Arzt in Passeier. Im Nachruf wird ein Mann beschrieben, der, allen Schwierigkeiten zum Trotz, seine gesamte ärztliche Laufbahn im Passeiertal verbracht hatte. Bei der Bevölkerung war er beliebt, bekannt für seine Gastfreundschaft und Geselligkeit, angesehen und geschätzt für seine Bemühungen als Arzt, Ehrenbürger von St. Leonhard und St. Martin.
Der Gesundheitszustand ist gegenwärtig recht gut, während im April und Mai Alles voll Lungenentzündung mit Influenza war, welche beide schlimmen Gäste aber an unserem geschickten Gemeindearzte Dr. Neurauter einen unerbittlichen Gegner fanden, vor dem sie schließlich die Waffen streckten. Aus dem Volksblatt vom 27.07.1892
Eduard Neurauter entstammt einer Bauernfamilie aus Längenfeld im Ötztal, er wurde dort 1845 geboren. Und obwohl er nicht aus einem bürgerlichen Hause kommt, hat er die Möglichkeit bekommen, das k.k. Gymnasium in Brixen zu besuchen und anschließend in Innsbruck das Medizinstudium zu absolvieren. Er kommt 1876, gleich nach Abschluss seines Studiums, als Gerichtsarzt ins Passeiertal, wo er 1879 Maria Wilhelm aus St. Leonhard heiratet. Sie wohnen damals noch im Deluccahaus. Maria Wilhelm stirbt dann jedoch 1887 im Alter von nur 30 Jahren an einer Leberentzündung. Bereits ein Jahr danach ist Eduard Neurauter mit Maria Linhart aus Meran verheiratet, 1889 kommt die gemeinsame Tochter Aloisa auf die Welt. Sie wird das einzige Kind des Paares bleiben.
An die “Neurauter-Frauen” erinnert heute nur noch das Familiengrab an der südlichen Mauer der Pfarrkirche. Auch die Mutter von Eduard Neurauter, Maria Plörer, ebenfalls aus Längenfeld, ist in diesem Grab bestattet worden. Sie starb nur zwei Wochen vor Maria Wilhelm, seiner ersten Frau. Über die einzelnen Familienmitglieder konnte ich aus den zeitgenössischen Quellen leider nur sehr wenig herausfinden. Es dominiert die Persönlichkeit des Gemeindearztes.
Links: Vermutlich Maria Wilhelm, erste Ehefrau von Dr. Eduard Neurauter, geboren am 10. Mai 1857 in St. Leonhard in Passeier, gestorben am 30. Juni 1887 in St. Leonhard in Passeier. Rechts: Vermutlich Maria Plörer, Mutter von Dr. Eduard Neurauter, geboren 1801 in Gries bei Längenfeld, gestorben am 15. Juni 1887 in St. Leonhard in Passeier.
Ein Arzt im Gebirge. Was es heißt, in dieser Zeit Gemeindearzt eines Hochgebirgstales zu sein, können wir mehreren Zeitungsartikeln entnehmen. Ein unbekannter Zeitgenosse schrieb dazu am 27.02.1912 in den Tiroler Stimmen als Nachruf eine persönlich erlebte Geschichte mit dem Arzt, welche über die Beschwerlichkeit jener Tage berichtet, dabei aber auch den Charakter Neurauters beschreibt:
Südtirol, 25. Februar. (Eine herzensgute Seele.)
Im Berichte der „T. St.“ Nr. 45 vom Tode des Dr. Neurauter von St. Leonhard i. P. schreiben Sie: „Er war eine herzensgute Seele“. Zum Beweise dieses Satzes kann folgende Erinnerung dienen.
Vor ungefähr 25 Jahren war ich einmal an einem Winterabend bei ihm auf Besuch. Er hatte gerade seine Pfeife angezündet und seine schneeigen Stiefel in der Küche ausgezogen; denn er war von einem Gange von Schlattach zurückgekehrt. Da kam ein Bauer von Obertall und bat ihn, zu seinem Weibe, welches im Wochenbett war, zu gehen. Er sei, so erzählt er, schon in der Früh vom Hause fortgegangen und sei den ganzen Tag herumgelaufen, um einen Arzt zu bekommen, habe aber keinen auftreiben können. Der Arzt in Schönna sei unwohl und könne nicht gehen und in Meran habe er mehrere Ärzte aufgesucht, aber keiner sei gegangen. Endlich habe er sich noch entschlossen, nach St. Leonhard in Passeier zu gehen.
Dr. Neurauter wandte ein, Tall gehöre nicht zu seinem Sprengel, man brauche über 4 Stunden, er sei schon ganz abgehetzt und müde, es schneie. Da unterbrauch ich ihn mit der Bitte: „Mein lieber Doktor, sei so gut und geh. Es gilt eine Frau im Wochenbett.“ Er schien dies erwartet zu haben, denn sogleich erwiderte er recht gutmütig: „Wenn du ihm auch noch hilfst, muss ich nachgeben. Gehen wir also in Gottes Namen.“ Ich wusste aus Erfahrung, dass man seinem Edelmute sehr viel und seiner Leistungsfähigkeit im Gehen Außerordentliches zutrauen konnte.
Indem nun seine Frau ihm ein Glas Wein vorstellte, schaute sie ihn mit einem Seitenblick auf den Bauer fragenden Blickes an. „Natürlich, sagte er, er braucht es notwendiger als ich.“ Sogleich brachte sie auch dem Bauer ein Glas Wein und suchte für ihn etwas aus dem Speisekasten heraus. Während der Doktor die Stiefel anzog, steckte ihm die Frau ein kleines Fläschchen „Holer“ und ein Stück Brot in die Rocktasche; dann ging es in die Winternacht hinaus, durch Schneegestöber in die Berge, Tall zu.
Als mir der Doktor am folgenden Tage begegnete, rief er mir schon von weitem zu: „Gott sei gedankt, dass ich gestern nach Tall gegangen bin; drei Personen habe ich das Leben gerettet; die Mutter und zwei Büblein sind frisch und gesund“ und sein ganzes Gesicht leuchtete vor Freide. Ich musste dann mit ihm gehen, um ein kleines Freudenfest zu feiern. Die Rechnung des Doktors an den Tallerbauern war dann so mäßig, dass sie selbst dem armen Bäuerlein zu niedrig schien. – Ja ja, der verstorbene Dr. Neurauter war wirklich eine herzensgute Seele.
Dies ist der einzige Bericht, in dem auch die Frau des Arztes erwähnt wird. Wobei unklar ist, ob es sich um seine erste Frau Maria Wilhelm oder um Maria Linhart handelt. Sicher ist jedoch, dass das Ehepaar Neurauter zu der beschriebenen Zeit noch im Deluccahaus wohnte. Der Artikel gibt außerdem eine Vorstellung davon, welche körperlichen Anstrengungen ein Arzt in unserer Gegend auf sich nehmen musste, besonders im Winter und zu einer Zeit, als es noch keine Talstraße gab und die Wege allgemein in sehr schlechtem Zustand waren.
Wer den schwierigen Beruf eines Arztes im Gebirge kennt, wird auch die Ovation begreifen, die dem Jubilanten von der Bevölkerung dieses Thales bei dieser Gelegenheit dargebracht wurde und die von dessen Beliebtheit Zeugnis gibt. Aus den Innsbrucker Nachrichten vom 08.01.1902 anlässlich der Feier zum 25 Jahr-Jubiläum von Dr. Neurauter als Arzt im Passeiertal.
Fein sein, gemütlich sein, fröhlich sein bei Sang und Klang. Ein vielbeschäftigter Mensch brauchte natürlich auch einen Ausgleich zu seiner anstrengenden Arbeit. Und die fand Eduard Neurauter, wie öfters berichtet wird, bei Musik und Geselligkeit, und im Besonderen bei einer Vereinigung namens Vince luna, auch genannt „Die Umgestülpten“, welche von Dr. Neurauter, genannt „Zeus“, 1898 gegründet wurde, und der er lange Zeit als Obmann vorstand. Dabei handelte es sich um eine Gesellschaft, welche aus Bürgern und Beamten des Dorfes bestand. So wurden neben regelmäßigen Treffen der Mitglieder auch besondere Feierlichkeiten mit dem vereinseigenen Streichorchester musikalisch begleitet, so z.B. die Feier für den neu ernannten Landesgerichtsrat Bezirksrichter Karl Delago. Auch Johann Wallnöfer, der ehemalige Hutmann am Schneeberg, war auf einer Durchreise Gast bei einer Sitzung von Vince luna: Die Sitzung dauerte aber sehr lange – der Mond hatte gesiegt, war aber schon im Verblassen. Da Eduard Neurauter in seiner Studienzeit Mitglied der Tiroler Studentenverbindung Corps Gothia war und von daher bereits mit dem Verbindungswesen vertraut war, könnte man Vince luna als eine Art „Weiterführung“ der Verbindungstätigkeit sehen.
In dieser Gesellschaft lebt noch der Geist Dr. Neurauters, der bis in sein Alter ein jugendfrisches, frohes Studentenherz bewahrte und wegen seiner Liebenswürdigkeit und Tüchtigkeit auch heute noch in der Erinnerung der Passeirer fortlebt. Aus dem Volksbote vom 17.05.1923, anlässlich der Feier zum 25jährigen Jubiläum von Vince luna.
Die selbsternannte „Intelligenz u. Halbintelligenz von St. Leonhard“, welche sich im Jahr 1907 beim Sandwirt zusammenfand und auf einem Foto verewigt wurde, schlug vermutlich in eine ähnliche Kerbe wie Vince luna: Eine Versammlung von lokalen Persönlichkeiten, Beamten und Vertretern der Geistlichkeit. Mit dabei ist auch Dr. Neurauter (sitzend, Dritter von rechts). Postkarte aus dem Jahr 1907 von Karl Gögele, dem späteren Dekan von St. Leonhard, an seinen Bruder Peter Gögele in Innsbruck. Mehr zur Postkarte.
Dr. Neurauther leidet wahrscheinlich an Gehirnerweichung, berichtete am 02.02.1912 der Tiroler Volksbote. Zwanzig Tage später verstarb er im Alter von 67 Jahren in St. Leonhard. Er wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung, Geistlichkeit, Verwaltung und Politik zu Grabe getragen. Einige der Gäste reisten dafür sogar mit dem Automobil aus Meran an.
Sterbebild Dr. Eduard Neurauter aus dem Archiv von Harald Haller.
Nach seinem Tod lebten die Witwe Maria Neurauter und die Tochter Aloisia (genannt die „Doktor Luise“) zurückgezogen im Doktorhaus. Maria Neurauter wurde bis zu ihrem Tod am 11.09.1937 von ihrer Tochter umsorgt. Danach erbte Tochter Aloisia das Haus und verkaufte es 1944 an den Gemeindearzt Dr. Romedius Ebner. Damit zog eine neue Arztfamilie ins Doktorhaus ein. Mit Aloisa Neurauter stirbt am 08.02.1966 das letzte Mitglied der Familie Neurauter, weitere Nachfahren sind bisher nicht bekannt.
Mittlerweile ist auch das Doktorhaus verschwunden, womit die Kohlstatt in St. Leonhard wieder einmal um ein historisches Gebäude ärmer geworden ist. Nach dem Schmiedhaus, dem alten Kindergarten und dem Lodenwalcherhaus musste nun auch das Doktorhaus einem Neubau weichen. Zumindest wurde so die Aufarbeitung der Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner*innen angestoßen, um das Doktorhaus auch der Nachwelt, wenigstens in dieser Form, erhalten zu können. Ja, das Doktorhaus, das war einmal…
Doktorhaus am 22.01.2023 – 28.01.2023 – 04.02.2023.
Falls du Fotos zum Doktorhaus hast, melde dich!
Wir würden sie sehr gerne sehen.
info@museum.passeier.it
Interessiert dich weitere Lektüre zum Doktorhaus?
Lies auch den Blogartikel zur Arzttochter Berta Ebner, die von 1930 bis 1980 im Doktorhaus lebte.
147 Nägel und ein Brett
Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.
Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.
Von Annelies Gufler
Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.
„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“
lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.
Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!
Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.
Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.
Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier
Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.
Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.
Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.
Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.
Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.
Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.
Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.
Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.
Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.
Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.
Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.
Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.
Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.
Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.
Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.
„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.
Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.
Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.
Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.
Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier
Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?
Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!
Liegengebliebenes
Die Geschichte von Berta Ebner, die mehr einstecken musste, als eine Bombe an ihrem Lebensende.
Das Puppenhaus der Berta Ebner fehlt, doch der Inhalt ist noch da. Viele werden wehmütig, wenn sie sich für die Zukunft eine Kohlstatt ohne Doktorhaus vorstellen müssen. Foto: MuseumPasseier.
Die Geschichte von Berta Ebner, die mehr einzustecken hatte, als eine Bombe an ihrem Lebensende.
Von Judith Schwarz
Die Tage nach Neujahr sind eigentlich Tage für Liegengebliebenes. Früher galt nämlich: Man kann sich “zwischen den Jahren” bis Dreikönig Zeit lassen für Dinge, die man im alten Jahr erledigen wollte. Für diesen Blogartikel über Berta Ebner, den ich vorhatte 2022 zu schreiben, ist der Zug also noch nicht abgefahren. Stay tuned!, sag ich mir seit Silvester, diese liegengebliebenen Zeilen dürfen getrost jetzt erst erscheinen.
Es begann im nunmehr vorjährigen Sommer. Ich hörte von der Historikerin Monika Mader zum ersten Mal von “Le strage di Bologna”, dem Anschlag von 1980 am Zugbahnhof von Bologna. In einem abgestellten Koffer im Wartesaal war eine Zeitbombe explodiert. Und ich hörte zum ersten Mal, dass auch eine ledige Passeirerin an jenem 2. August um 10:25 Uhr auf einen Zug gewartet hatte. Um inmitten der Explosion, die vermutlich Neofaschisten zu verantworten hatten, zu sterben.
Sollte ich über diese Frau schreiben? Berta Ebner war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ihr Leben möglicherweise bis zu jenem 2. August 1980 friedlich und unauffällig verlaufen. Ihre Eltern und Geschwister nicht mehr am Leben, ihr Nachlass nach über 40 Jahren höchstwahrscheinlich verschollen.
Trotzdem begann ich zu suchen: Warum war Berta Ebner, die Tochter des Gemeindearztes von St. Leonhard, an jenem Tag in Bologna gewesen? Wer war diese Arztfamilie, die in einer Jugendstil-Villa im Dorf gelebt hatte? Können sich die älteren Passeirer*innen noch an die “explodierte” Arzttochter erinnern?
Das 120 Jahre alte Doktorhaus der Familie Ebner mit südseitigem Balkon, zierlichen Holzbögen und filigranem Gusseisengeländer ist im Passeier ein einmaliges Beispiel für den Architekturstil der Belle Époque. Foto: Monika Mader.
Berta Ebner war so unauffällig, dass es auffällig ist. In den Zeitungsberichten zum Bomben-Attentat finden sich immer wieder dieselben Informationen: Die Verstorbene aus St. Leonhard in Passeier war 50 Jahre alt, ledig, Hausfrau, führte ein zurückgezogenes Leben, pflegte ihre 84-jährige Mutter, war zufällig auf Italienreise gewesen. Ihr Passfoto taucht auf einigen Websites auf, welche die Erinnerung an die 85 Todesopfer des Anschlages wachhalten wollen und dazu jährlich am 2. August Gedenk-Aktionen starten.
Im Sommer 2022 wurden symbolische Koffer als Mahnrufe zur Erinnerung an das Bombenattentat von 1980 verschickt. Da Berta Ebner ledig verstorben war, strandete “ihr” Koffer in der Gemeinde St. Leonhard in Passeier. Und wurde zum Weckruf für Recherchen für das MuseumPasseier. Foto: Fabian Pfeifer.
Um zu erinnern, muss man wissen. Je weniger Kenntnis wir über Berta Ebner haben, umso schneller wird ihr Leben ein leeres Blatt Papier werden. Das Schwarz-Weiß-Foto von Berta bunt zu bemalen und in einem weiß gestrichenen Koffer von Bologna nach Passeier zu schicken, wird das nur bedingt verhindern. So dachte ich, als ich im Sommer von der jüngsten Erinnerungs-Aktion “A destino” hörte. Nun, ein halbes Jahr später, zeigt sich: Der symbolische Koffer hat nicht nur still vor sich hin gemahnt. Er ist zum Auslöser geworden, um weitere Spuren zu Berta Ebner zu suchen.
Wo sucht man am besten nach Ebners? Natürlich in Zeitungen. Und tatsächlich taucht Berta Ebner bereits vor ihrem tragischen Tod in Bologna 1980 in einem Bericht in den Dolomiten auf, nämlich 1958 in Sorrent bei Neapel. Als 28-jährige Frau hatte sie dort – aus welchen Gründen auch immer – ihr Gedächtnis verloren! Laut Zeitungsnachricht war sie verwirrt, aber unverletzt – und man fand weder bei der Polizei noch im Krankenhaus Näheres heraus: “Mutter und Schwester kamen nach Neapel, doch konnte sich Berta Ebner an sie nicht ‘erinnern’ und auch jegliches Zureden war umsonst. Sie tat, als ob Mutter und Schwester ihr vollkommen unbekannte Leute wären.” Also “[…] kehrten Mutter und Schwester mit Berta nach Sankt Leonhard zurück und die Aerzte hoffen, daß das arme Mädchen in ihrer gewohnten Umgebung die Erinnerungsgabe wieder erhalten werde.”
Berta mit weißer Strickjacke und ernstem Gesicht im Kreis ihrer Familie. Mit 28 Jahren erleidet sie in Süditalien einen Gedächtnisverlust, das Foto könnte kurz vor oder nach dieser Zeit entstanden sein. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier, Fotograf: unbekannt.
Ein ruhiges und unauffälliges Leben? Davon bekommt man keine Amnesie. Eher von traumatischen Erlebnissen, von Unfällen, Stress oder Schock. Wir wissen nicht, ob oder wann Bertas Erinnerungen zurückgekehrt sind. Oder wie in der Passeirer Arztfamilie mit dem Gedächtnisverlust umgegangen wurde. Und vor allem was ihn ausgelöst hat. Auch wenn der Zeitungsbericht dazu schweigt, in einem Dorf wird immer geredet. “Berta hat studiert gehabt und hatte irgendwann ein Kind, das haben ihr die Eltern aber genommen, weil es ein “Italienerkind” war. Man hat nie gehört, ob Mädchen oder Bub und wo das Kind überhaupt ist", erzählen ehemalige Nachbarn der Ebners.
Möglich wär es schon. Dass Bertas Amnesie in Süditalien eine Schockreaktion auf ein Ereignis war, das mit ihrer Schwangerschaft oder mit der Wegnahme ihres Babys zu tun hatte. Für die Einheimischen ist klar: “Man hat ihr das Kind genommen, und dann ist die Berta übergeschnappt. Da hat es dann Probleme gegeben, dass sie zum Beispiel im Unterrock umhergegangen ist und so.”
Umgekehrt wäre es auch denkbar. Zumindest solange wir keine Angaben zum Geburtsdatum des Kindes haben (im Grunde haben wir nicht mal gesicherte Angaben zur Existenz des Kindes). Was, wenn Berta erst in Folge ihres Blackouts “Probleme” gemacht hat und eines dieser Probleme die Schwangerschaft war? Die Geburt des Kindes, irgendwo auswärts, soll in den 60er Jahren gewesen sein, als Berta rund 30 Jahre alt war, glauben Leute im Dorf zu wissen. Ganz genau können sie ihre Erinnerungen allerdings auch nicht abrufen.
Also vielleicht doch Nachkommen! Das (vermutete) Kind könnte heute zwischen 60 Jahre alt und älter sein und irgendwo in Italien leben. Berta soll gerne Italienreisen unternommen haben, wird in den Zeitungsberichten zu ihrem Tod betont. Was, wenn diese Reisen in irgendeiner Weise mit ihrem Kind zusammenhingen? Was, wenn das “Italienerkind” der Grund gewesen ist, warum Berta am 2. August 1980 am Bahnhof in Bologna auf einen Zug gewartet hat?
Im Dorf wurde gemunkelt. “Die Leute haben immer spekuliert, dass Bertas Bruder das Kind nach Deutschland mitgenommen hat”. Aber Bertas älterer Bruder Romed (1923–2011), zum Zeitpunkt der Amnesie bereits Arzt wie sein Vater, heiratete eine Biologin und gründete vor seinem Tod eine Stiftung zur Unterstützung von Medizinstudent*innen, in die sein Vermögen floss. Von einem Kind keine Spur. Bertas jüngere Schwester Elisabeth (1933–2015) hingegen war ab 1962 verheiratet, mit einem Arzt, und hatte einen Sohn.
Und Berta als Jugendliche? Sie scheint bereits als junge Frau gegen Korsette rebelliert zu haben. Über ihre Zeit als Studentin (wahrscheinlich der Pharmazie) und das Maturajahr 1949 am wissenschaftlichen Lyzeum in Brixen ist wenig bekannt. Mit 13 Jahren war sie jedoch im 360km entfernten Bregenz in Österreich im Internat untergebracht. Die dortige staatliche Oberschule für Mädchen und das Schülerinnenheim “Marienberg” liegen in der Nähe von Heimertingen, der Heimatstadt ihrer Mutter Berta Ebner geb. Schneider (1895–1980). Berta schreibt pampige Briefe über ihre Mitschülerinnen (“zwiedere Pfotten”) und das Essen (“Fetter kann man hier auch nicht werden”). Die Internatsleitung klagt, Berta sei nicht willens, sich einzufügen.
Ein lebensfrohes Kind, wie es alle anderen sind. Das solle mit ihrer Hilfe aus Berta werden, sendet die Heimleiterin nach Passeier und fügt – wir haben das Jahr 1943 – “Heil Hitler!” hinzu. Eine schwierige Aufgabe, da Berta stets als “sehr verschlossen” beschrieben wird. Vielleicht hatte sie es bereits in ihrer Grundschulzeit in St. Leonhard schwer, Anschluss zu finden – als bürgerliche Tochter eines Arztes und einer Reichsdeutschen. Bertas Lebensfreude zu wecken scheint dem Bregenzer Internat jedenfalls nicht gelungen zu sein: Berta wechselt die Schule und schließt das Schuljahr 1943/44 an der Mädchenoberschule St. Christina in Gröden ab. Im Jahreszeugnis ist zu lesen: Verschließt sich scheu den Kameradinnen.
Das Ehepaar Ebner posiert um 1925 mit seinen Kindern Berta und Romed. Auf dem unteren Foto die selbe Szene, etwa fünf Jahre später: Die erstgeborene Berta ist inzwischen verstorben, Romed zum Schulkind gewachsen und die “nächste Berta” dazugekommen. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier, der/die Fotograf/en ist/sind unbekannt.
Bertas Distanziertheit hat vielleicht auch andere Gründe. Berta ist nämlich nicht die erste Berta, sondern die zweite. 1921 bekommen Berta Schneider und ihr Gatte Romedius Ebner ihr erstes Töchterchen Berta, zwei Jahre später den schon erwähnten Sohn Romed. Am 12. Mai 1929 feiert das achtjährige Mädchen ihre Heilige Erstkommunion, zwei Tage später stirbt sie plötzlich. “Die Berta hat auf dem Bichl oben Wasser getrunken. Und man hat immer gesagt, sie hat eine ‘Iifer’ (Fadenwurm) getrunken und ist daran gestorben. Das ist sehr schnell gegangen.” Für eine Familie, die einen Arzt im Haus hat, ist dieser Tod doppelt schwer zu schlucken. Knappe neun Monate später kommt Berta auf die Welt.
Auf dem Dachboden des Doktorhauses lagern noch die Druckplatte der Sterbebildchen für “unser liebes Kind Berta Ebner, Arztenstöchterlein” und etliche Exemplare nicht verteilter Sterbebilder. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier.
Ein 8-jähriges Kind plötzlich zu verlieren bedeutet Familienkrise. Zumal in einem bürgerlichen, konservativen Kreis, in dem man bedrückende Lebensumstände lieber unter den Teppich kehrt, als unglücklich aufzufallen. “Die Frau Doktor hat viel gefragt, aber umgekehrt hat man über sie nie etwas erfahren.” Nichtsdestotrotz, dass die “alte Ebnerin” ihren Mann und Passeier hat verlassen wollen, weiß man sich in St. Leonhard heute noch zu erzählen. Und auch, wie sie beim Ausbrechenwollen blamiert zurückruderte, als ihr Mann beim Kofferpacken half. Berta erlebt eine Mutter, die im Tal wenig beliebt und unglücklich ist. Die Frau Doktor, die hochdeutsch gesprochen hat, galt als geizig, pingelig und äußerst streng. War andererseits aber selbst in einem gestrengen, abgehobenen Milieu gefangen.
“Der Doktor Ebner ist ganz ein Angenehmer gewesen, die Leute haben ihn sehr geschätzt. Er war ruhig, ausgeglichen, sehr loyal. Schlimmer ist seine Frau gewesen, aber das könnt ihr nicht schreiben.” Berta Schneider (1895–1980) und Romedius Ebner (1886–1967) als junges Paar. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier.
Ein Leben mit ihren Eltern. Als der Bruder als Arzt Karriere in Deutschland macht und die Schwester einen Arzt heiratet und fortzieht, bleibt Berta der Part der ledigen Tochter, die sich um die alternden Eltern kümmert. Vielleicht waren ihre Italienreisen auch eine Flucht vor dem Leben im Elternhaus in St. Leonhard?
Mutter und Tochter leben sehr zurückgezogen. Erst recht nachdem 1967 Bertas Vater 81-jährig verstorben ist. Als dann im August 1980 Berta in Bologna ums Leben kommt und wenige Monate später ihre Mutter an Herzinfarkt und Lungenentzündung stirbt, bleibt das Bürgerhaus der Ebners am westlichen Ortrand von St. Leonhard leer zurück. Vier Jahrzehnte und einen Besitzerwechsel mit Renovierungsplänen später steht es nun vor dem Abriss. Im November 2022 machten Monika Mader und ich einen Hausbesuch. Und fanden in der Doktorvilla so etwas wie Berta Ebners Chance, nicht vergessen zu werden.
Von wegen verschollener Nachlass! Unmengen von Schulheften, Studiennotizen, Unibüchern. Gemälde von unbekannten Vorfahren. Zu Paketen geschnürte Briefe. Kisten voller Fotos von Urlaubsreisen. Spielsachen der verstorbenen Schwester. Arztbesteck. Praxisschilder. Traueranzeigen. Zeugnisse. Ein Röntgenbild. Ein Herbarium. Ein Kinderbett. Bertas Geschwister Romed und Liesl hatten wohl keine Verwendung für die Habseligkeiten. So sind sie über eine Zeit von über 40 Jahren liegen geblieben.
Das Liegengebliebene seinerseits wird seine Zeit brauchen. Um gesichtet, erkannt oder verkannt zu werden. Um geordnet oder durcheinander gebracht zu werden. Oder um liegen zu bleiben. Stay tuned!
Du hast weitere Informationen oder Quellen zu Berta Ebner und ihrer Familie?
Bitte lass sie nicht liegen, sondern schick sie uns oder erzähl uns davon!
Giovanni Falcone e il mare
A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il Museo ospita tre oggetti personali del “cacciatore di mafiosi”,
Quello che molti non sanno: Il famoso “cacciatore di mafiosi” Giovanni Falcone sognava da giovane una carriera in marina. Foto: MuseoPassiria
A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il “cacciatore di mafiosi”, il Museo ospita alcuni oggetti personali appartenuti al magistrato per la mostra “Eroi & Noi”. Gli oggetti sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Falcone di Palermo.
Di Josef Rohrer
Nel 1957 all’età di 18 anni Giovanni Falcone entrò all’Accademia navale di Livorno. Avrebbe potuto intraprendere una carriera nella Marina italiana. Ma poco tempo dopo abbandonò l’Accademia, iniziò gli studi di Giurisprudenza, divenne giudice istruttore e in seguito membro di un’unità speciale di giustizia contro la mafia a Palermo. Nei primi anni Ottanta mediante verifiche bancarie fu in grado di mettere in luce gli stretti collegamenti tra Cosa Nostra in Sicilia e la mafia negli Stati Uniti.
Fu ripetutamente minacciato, sia politici sia elementi dell’apparato giudiziario cercarono di ostacolare il suo lavoro. Il Pool Antimafia, del quale faceva parte oltre a Falcone tra gli altri anche Paolo Borsellino, riuscì tuttavia a indebolire la mafia giungendo a celebrare un maxiprocesso. La mafia si vendicò a modo suo: nel maggio 1992 fece esplodere una bomba sull’autostrada nei pressi di Palermo. Falcone, la moglie e tre agenti della scorta morirono nell’attentato. Due mesi più tardi nel centro di Palermo la mafia assassinò anche Borsellino e i cinque agenti che erano con lui.
La sorella di Falcone, Maria, ha istituito una Fondazione allo scopo di tenere vivo il ricordo della coraggiosa lotta di Falcone contro la mafia. Su richiesta del MuseoPassiria la Fondazione mette ora a disposizione per la sezione espositiva “Eroi & noi” il berretto bianco con la scritta “Accademia navale” indossato da Falcone a Livorno, insieme al suo tesserino di riconoscimento: entrambi gli oggetti personali risalgono all’epoca “dei sogni”, come scrive Alessandro de Lisi della Fondazione, quando Falcone poteva ancora imprimere alla sua esistenza un percorso diverso.
attraverso l’esposizione di alcuni oggetti selezionati. In mostra sono presenti tra gli altri cimeli del Dalai Lama, di Monika Hauser, fondatrice dell’organizzazione umanitaria Medica Mondiale, e del vescovo Erwin Kräutler, che nonostante le minacce di morte combatté per i diritti degli Indios in Brasile.
Tre oggetti personali del più famoso cacciatore di mafiosi della storia italiana sono ora esposti al MuseoPassiria. Foto: MuseoPassiria
La sezione “Eroi & noi” del MuseoPassiria è dedicata al tema di come vengono visti oggi eroi, star e idoli.
Der Mafiajäger und das Meer
30 Jahre nach dem Mord an Giovanni Falcone bekommen wir persönliche Objekte des berühmten Mafiajägers.
Was viele nicht wissen: Der berühmte Mafiajäger Giovanni Falcone träumte in jungen Jahren von einer Karriere bei der Marine.
30 Jahre nach dem Mord am bekanntesten Mafiajäger der italienischen Geschichte bekommt das MuseumPasseier persönliche Objekte von Giovanni Falcone. Zur Verfügung gestellt hat sie die Falcone-Stiftung in Palermo.
Von Josef Rohrer
Giovanni Falcone war 1957 als 18-Jähriger in die Marineakademie von Livorno eingetreten. Er hätte in der italienischen Marine Karriere machen können. Aber er verließ die Akademie nach kurzer Zeit, studierte Jura und wurde Untersuchungsrichter in Trapani und später Mitglied einer Sondereinheit der Justiz gegen die Mafia in Palermo. In den frühen 1980ern legte er über die Auswertung von Banküberweisungen enge Verbindungen zwischen der Cosa Nostra in Sizilien und der Mafia in den USA offen.
Er erhielt häufig Drohungen. Politiker und auch Teile des Justizapparates versuchten, ihn in seiner Arbeit zu behindern. Dennoch gelang dem sogenannten Pool Antimafia, dem neben Falcone unter anderem auch Paolo Borsellino angehörte, mit einem großen Prozess eine Schwächung der Mafia. Sie rächte sich auf ihre Weise: Im Mai 1992 explodierte auf der Autobahn bei Palermo eine Bombe. Falcone, seine Frau und drei Leibwächter starben. Zwei Monate später ermordete die Mafia mitten in Palermo auch Borsellino und fünf seiner Begleiter.
Falcones Schwester Maria gründete eine Stiftung. Die Erinnerung an Falcones mutigen Kampf gegen die Mafia sollte wachgehalten werden. Auf Anfrage des MuseumPasseier stellte die Stiftung für die Ausstellung „Helden & Wir“ jetzt die weiße Kappe mit der Aufschrift „Accademia navale“ zur Verfügung, die Falcone in Livorno getragen hatte, sowie seine Kennkarte: Persönliche Objekte aus einer Zeit „der Träume“, wie Alessandro de Lisi von der Stiftung schreibt, als Falcone seinem Leben noch eine andere Richtung hätte geben können.
“Die ausgewählten Objekte für das MuseumPasseier sind drei Zeugnisse einer andauernden Leidenschaft für das Meer, einer Ära der Träume und einer grundlegenden Zeit der Ausbildung dieses heute historisch berühmten Richters Giovanni Falcone”, schreibt die Stiftung Falcone. Foto: MuseumPasseier
Die Ausstellung „Helden & Wir“ handelt davon, wie Held*innen, Stars und Vorbilder heute gesehen werden.
Einen Schlern, bitte!
Über eine schrecklich große Familie.
Fotos: MuseumPasseier
Über eine schrecklich große Familie.
Von MuseumPasseier
Seit 1920 gibt es die Zeitschrift DER SCHLERN. Anfangs halbmonatlich, später monatlich erschien sie und erscheint sie immer noch. Der passionierte Sammler Florian Pichler aus Meran hat dem MuseumPasseier die Hefte von 1920 bis 1997 geschenkt, das sind *Trommelwirbel* 812 Ausgaben!
Wie kommt ein 3,40m hoher Berg an Zeitschriften zustande? Irgendwann in den 1970er Jahren hat sich Pichler zum Ziel gesetzt, alle Schlern-Ausgaben aufzuspüren und zu erwerben. Der Knackpunkt: Mit dieser Idee war er damals nicht alleine, es gab einen regelrechten Sammelboom in ganz Tirol und dementsprechend begehrt waren vor allem die 50 Jahre alten Ausgaben.
Zeitschriften als Sammlerstücke – wir dachten, das funktioniere nur bei coolen Comics. Tatsächlich aber wurden die biederen heimatkundlichen Hefte mit dem Erkennungszeichen der Schlernsilhouette in Sammlerkreisen verkauft und getauscht wie heute Pokémon-Karten. Mit anderen Sammler*innen war man per Post in Kontakt, man bedenke die Zeiten: Sobald man die eigene Liste mit den „Fehlschlernen“ und „Doppelschlernen“ per Brief geschickt und eine positive Antwort, ebenfalls per Brief, erhalten hatte, wechselten die Exemplare – gut verpackt und frankiert – die Haushalte.
Was fehlt, was ist doppelt? Der Sammler Florian Pichler hatte irgendwann alle Nummern auf seiner Liste durchgestrichen, heute befinden sich seine 812 Ausgaben der Zeitschrift „DER SCHLERN“ im MuseumPasseier. Foto: MuseumPasseier
Was man nicht im Tausch bekam, wurde anders aufgespürt. Es waren entweder glückliche Einzeltreffer aus Privathaushalten, oder – sehr begehrt – mehrere Ausgaben in Bibliotheken. So hat Florian Pichler einige Exemplare von ehemaligen Meraner Hotelbesitzer*innen erworben, die ihren Betrieb geschlossen und in Folge auch ihre Gästebibliothek verkauft haben.
Einige Vorbesitzer*innen hängen an ihren Heften. Nicht nur emotional, sondern wortwörtlich. Als Buchbesitzerkarte, meist ein Holzdruck, kleben in einigen Ausgaben sogenannte Ex-Libris auf der ersten Innenseite, so etwa von Bruno Pokorny (1941-2014). Das Ex-Libris “DÖS G`HEART MIR” von Sammler Florian Pichler ist natürlich auch immer wieder zu finden, schon allein der Ordnung halber.
Ordentlich ist auch, was danach kam: Aus 12 mach 1. Die meisten Sammler*innen ließen, sobald sie alle zwölf Hefte eines Jahrganges beisammen hatten, diese als Buch binden. Pichlers Reihe besteht aus 71 dicken Bänden in hellem Leinen. Wer jetzt nachrechnet: Die Jahrgänge von 1920 bis 1997 ergeben 78 Bände, und nicht 71. Die fehlenden sieben Bände sind die Jahrgänge 1939 bis 1945. In diesen Jahren des Nationalsozialismus war anfangs DER SCHLERN in DER SCILIAR umbenannt und danach das Erscheinen der Zeitschrift verboten und der Druck eingestellt worden. Erst 1946 erließ die alliierte Verwaltung wieder eine Druckerlaubnis.
Und was macht man, wenn man alle Hefte beisammen und gebunden hat? Dann, so erzählt Florian Pichler, habe er ein Fest mit befreundeten Schlernsammler*innen gefeiert. Irgendwie erfreute er sich nämlich nicht nur an der Gesamtheit der Schlernhefte als sogenannte „Schlernfamilie“, sondern er hatte auch die dazugehörigen Sammler*innen ins Herz geschlossen.
Du brauchst ein PDF eines Schlern-Artikels? Schreib uns!
Süßsaure Geschichten
Wir haben in das Thema Apfel gebissen.
Streuobstwiese mit Apfelbäumen beim Weiherhof in Breiteben, Gemeinde St. Martin in Passeier. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier
Wir haben in das Thema Apfel gebissen.
Von MuseumPasseier
“Irgendwann werden die alten Apfelbäume verschwunden sein!”: Diese Aussage von Adolf Höllrigl, der im Museum zu einem Interview über Zullen geladen war, brachte uns zum Nachdenken. Denn bei alten Dingen, die verschwinden, hören und schauen Museen ja meist genauer hin. Allerdings können wir die noch erhaltenen Passeirer Streuobstwiesen mit den knorrigen Bäumen nicht museumsgerecht im Depot konservieren. Doch wir können sie fotografieren und für deren Erhalt sensibilisieren. Oder auch anregen, wieder vermehrt alte Sorten als Hochstämme zu pflanzen.
Also haben wir in das süß-saure Thema Apfel gebissen. Süß, weil es spannend und wertvoll ist. Sauer, weil es keine Passeirer Literatur oder Erhebung dazu gibt. Um die geschichtliche und heutige Situation der Apfelbäume in Passeier zum Museumsthema zu machen, haben wir der Volkshochschule Südtirol einen Vortrag vorgeschlagen. Und uns gemeinsam mit den Referenten Adolf Höllrigl und Wolfgang Drahorad auf die Suche nach historischen und gegenwärtigen Passeirer Äpfeln gemacht.
Wie viel Apfelgeschichte gibt die Passeirer Geschichte her? Dass es keine umfassende Dokumentation werden konnte, war klar. Aber auch einige kleine Apfelschnitz können reichen, um auf den Geschmack zu kommen. Apfelbäume gehörten einst zu fast jeder Hofstelle oder jedem Pfarrhaus – dennoch schweigen die älteren Quellen zu Apfelsorten und Apfelanbau in Passeier. Vereinzelt findet man in Verfachbüchern allgemeine Erwähnungen wie Baumgarten, Obis anngerle usw. Und höchstens fallen einem noch die Passeirer Kraxenträger ein, die verschiedene Obstsorten transportierten und verkauften. Allerdings hat von denen natürlich keiner Buch geführt.
Interessant wird es in den 1830er Jahren: Johann Jakob Pöll (1781–1848) war ein vom Pöllhof in Ulfas gebürtiger Priester, der alle möglichen Dinge auf die Beine stellte: Als Lehrer und Direktor an einer Stadtschule in Bozen gründete er eine Bibliothek, errichtete eine Industrieschule für Mädchen, unterrichtete Taubstumme, sammelte Münzen und züchtete Obstbäume. Seine apfelkundlichen Beobachtungen hielt er in Texten und Zeichnungen fest und gab dazu 1831 im Eigenverlag ein Buch zur Pomologie mit zahlreichen Holzschnitten heraus. Es gilt heute als das früheste Südtiroler Buch über Obstbaumzucht. Dass es keine Passeirer Apfel-Literatur gibt, ist also zu revidieren: Ein Passeirer hat literarisch Obstbaugeschichte geschrieben!
Titelblatt und Innenseite der frühesten Südtiroler Publikation über Obstbaumzucht, geschrieben von Johann Jakob Pöll aus Ulfas in Moos in Passeier. © tessmann.it
Was bedeutete Pölls Pomologie-Buch für Passeier? 33 Jahre nach Erscheinen von Pölls “Anleitung zur Obstbaumzucht” und damit auch lange nach Pölls Tod, kam es in St. Martin zur ersten landwirtschaftlichen Vereinsversammlung. Zum Obmann gewählt wurde der Dorfarzt Johann Hillebrand (1812–1886) und unter den ersten gefassten Beschlüssen findet sich auch „die Hebung der Obstzucht“. Was dieser Beschluss in der Obstbaumszene bewirkt hat, konnten wir nicht feststellen.
1924 dann ein Highlight in Bezug auf die Passeirer Obstgeschichte: Im Frühjahr hatte die landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaft in St. Leonhard einen Obstbaukurs organisiert, im Herbst wurde dann sozusagen geerntet. Im Speisesaal des “Passeirerhof” fand eine viertägige Obstsortenschau samt Vorträgen mit Begehungen statt. An dieser ersten Sortenschau haben 32 Obstzüchter aus Passeier teilgenommen, die insgesamt – man lese und staune – 48 Apfelsorten präsentierten.
Das Erinnerungsfoto zum Obstbaukurs in St. Leonhard stammt aus der Sammlung Alfons Schenk, der Fotograf ist unbekannt. © MuseumPasseier
48 Apfelsorten aus Passeier, die wären heute nicht auffindbar. Die Schau, die in den lokalen Zeitungen besonders erwähnt wird, war zur damaligen Zeit eine Besonderheit. Der Schreiber der Bozner Nachrichten beendet den Artikel mit dem Aufruf: „Andere Täler, nehmt euch ein Beispiel!“ Unter den Ausstellern waren unter anderem (aus St. Martin) der Kaufmann Alfons Schenk, (aus St. Leonhard) der Kaufmann Johann Delucca, Anton Fauner von Happerg, Leonhard Kofler von Unterzögg, Franz Hofer von Wiedersicht-Felsenegg, Josef Bacher vom Straußengütl, der Pfarrwidum, Josef Halbeisen vom Krustnerhof, Josef Gufler von Buchenegg, (aus Moos) Josef Pamer von Magfeld, der Platterwirt Johann Hofer, Georg Öttl von Obermagfeld, Josef Raffl aus Stuls.
In dieser Zeit überrascht auch außerhalb des Tales ein Passeirer als Fachmann: Rudolf Schiefer (1880-1970) aus St. Leonhard. Kurioserweise schaffte er es als lediger Bub, der nach dem frühen Tod seiner Mutter in armen Verhältnissen und auf verschiedenen Höfen aufgewachsen war, an die renommierte Landwirtschaftsschule San Michele all`Adige, die zu der Zeit hauptsächlich Gutsbesitzern- und Adelssöhnen vorbehalten war. Ab 1908 war er selbst als Lehrer an der Schule tätig und forschte über landwirtschaftliche Anbaumethoden – für Obst und vor allem für Reben. Nebenbei war er ständig als Wanderlehrer auf Achse und auch viel im Passeier unterwegs. Älteren Generationen ist er noch als „der alte Schiefer“ oder „Schnitzer Ruudl“ bekannt.
Schiefer Rudolf (im hellen Mantel) mit seinen Schülern des Rebveredlungskurses und Lehrerkollegen im Weininstitut San Michele (ca. 1930). Foto: Sonja Schiefer
Und wer sticht unter den frühen kommerziellen Passeirer Apfelbauern hervor? Ein jüngeres Beispiel für einen Passeirer, der immer wieder in Zusammenhang mit Obstbau auftaucht, ist Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard. 1905 verpachtete er dem k.k. Arär, also dem Staat, 799 m² Ackergrund zur Anlage und zum Betrieb einer Baumschule. Unter seinen Unterlagen, die die Familie verwahrt, finden sich noch Aufzeichnungen, ein Arbeitsbüchl und auch Schreiben der C.A.F.A. (Cooperativa Anonima Frutticoltori Alto-Atesini Merano), die 1933 gegründet worden war und der im Laufe der Zeit etliche Passeirer Bauern wie Anton Fauner beigetreten waren. Sein Enkel Reiner Fauner erinnert sich noch an den Pflanzgarten und die Äpfel seiner Kindheit:
Zu Hause hatten wir jeden Tag Kompott. Aber den hatten wir auch gerne. Strudel hat die Mutter viel gemacht, da nahm sie hauptsächlich die Kanada und auch für den Kompott. Bratäpfel und Most hat es auch gegeben.
Zur Pause in der Schule hatten wir immer einen Apfel mit. Ich hab selbst oft gestaunt, weil die Äpfel haben wir nie genug mitgetragen in die Schule, denn alle wollten mit uns ihr Pausenbrot mit den Äpfeln tauschen. Die einen waren um die Äpfel froh und wir hatten ihre Brote gerne.
Wir haben als Kinder immer gepflückt. Wir sind am Morgen pflücken gegangen anstelle des Kirchengangs vor der Schule, haben eine Stunde gepflückt, sind dann Schule gegangen, nach Hause zum Mittagessen, dann ist wieder gepflückt worden. Wir waren nur alleine als Kinder. Wir hätten auch lieber etwas anderes getan, konnten aber auch nichts andres tun, denn diese Arbeit war zu verrichten.
Den Arbeitsschritt, wie das Auszupfen, wie man es heute im Frühjahr macht, gab es damals nicht. Im Herbst wurde gepflückt, im Sommer manchmal gespritzt. Der Vater hat Schläuche angerichtet, die wir nachziehen mussten. Er hat es so angerichtet, dass oberhalb des Hauses eine Rease (Wasserteich) war. Da hat er das Spritzen angerichtet, also eine Pumpe und mit den Leitungen zum Herumleiten.
Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard, inmitten seiner Obstbäume. Foto: Gregor Fauner
Im undatierten Arbeitsbüchl erwähnt Anton Fauer (1875–1955), auch Arbeiten an den Obstbäumen. Der Kalender befindet sich im Besitz der Familie Ingo Fauner. Foto: MuseumPasseier
Alte Sorten hatten wir hauptsächlich Goldparmän und Kalterer. Die Sortennamen haben wir alle gekannt. Edelrote sind vor dem Haus zwei, drei Bäume gestanden, einige ziemlich große und ein paar Kanada auch. Die Boscoop waren gute, ein bisschen säuerlich aber eher spätere. Zum Kompott machen sind sie supergut gewesen. Von den Grafensteinern hatten wir auch zwei Bäume.
Der Vater wollte das Geschäft mit den Äpfeln groß aufziehen, doch einige Jahre waren die Äpfel fast gar nichts wert. Er hat zu uns gesagt, dass er uns für die Arbeit mit den Äpfeln keinen Lohn geben kann, gescheiter sollen wir einer Arbeit nachgehen. Er hat dann entschieden, dass er den Anger planieren will und hat fast alle Apfelbäume herausgeschnitten, dann kam die Firma Peer von Latsch und hat alles angeebnet.
Der Ëpflpåtsch, das sind die ausgepressten Äpfel, der kam erst später auf, den hat man bei der C.A.F.A. oder beim Zipperle gekauft, um das Vieh zu füttern: Äpfel aufschneiden und dann pressen und was davon übrigblieb, war der „Ëpflpåtsch“. Den hat dann das Rindvieh als Futter bekommen.
Und der „Ëpflpåtsch“ ist dann meinem Vater und meinem Bruder Gernot zum Verhängnis geworden. Und auch nur weil kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, denn auf dem Apfelsilo drauf ist die Gebläsehechsel gestanden, lässt man die an, ist die Luft sauber. Das war dann eben auch der Zufall, dass der Schneider Albert eine Ladung „Ëpflpåtsch“ gebracht hat und er gesagt hat, dass er nochmal kommen wird und hat die Luke offenlassen. Er wollte dann erst wieder am nächsten Tag kommen. Wenn die Luke zu gewesen wäre, wäre mein Bruder erstens nicht runtergesprungen und mein Vater nach um ihn zu retten, und zweitens hätten sich nicht diese Gase gebildet. Das sind eben immer diese Zufälle.
Ich war nicht zu Hause, ich glaube ich war im Dorf, da war ein Markt. Mich hat „der Spitaler“ angesprochen. Ich solle nach Hause gehen, zu Hause ist etwas passiert. Ich habe gefragt was los ist, er sagte „Einer ist in den Silo gefallen“ und ich hab kaltschnäuzig zur Antwort gegeben: „Dann wird er wohl wieder raufgehen!“. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, was passiert ist. Bis die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gekommen ist, hat es zu lange gedauert. Fünf bis zehn Minuten hat man Zeit, sonst ist das Hirn kaputt. Zu leiden haben sie nicht gehabt, das geht schnell. Der Silo ist auch falsch gebaut gewesen. Er ist 6 Meter tief gewesen und ohne Luftloch. Danach haben sie dann, wenn neue Apfelsilos gebaut worden sind, überall Luftlöcher eingebaut.
Wir danken Reiner Fauner fürs Erzählen seiner Familiengeschichten, in denen Äpfel gute und auch traurige Rollen spielen. Gerne veröffentlichen wir hier weitere Passeirer Apfelgeschichten, schreib deine einfach in die Kommentare oder schick eine Mail an info@museum.passeier.it
Eine moderne Chronik
Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht!
© design.buero
Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht.
Von MuseumPasseier
Was wäre, wenn ein Dorf eine Chronik plant, die alle Buchseiten und Gemeindegrenzen sprengt? An der nicht nur der Dorfchronist, ein Lehrer, ein Archäologe und eine Studentin arbeiten, sondern ALLE, die etwas zu erzählen oder zu zeigen haben? Wenn diese offene Chronik im digitalen Raum ständig wachsen würde, weil jede*r darin ergänzen, verbessern, verknüpfen, recherchieren, stöbern und spielen kann?
Wir freuen uns, Teil so einer Chronik zu sein, die derzeit mit Bildungsausschuss und Gemeinde St. Martin in Passeier entsteht. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu den offenen Chronik-Workshops in die lese.werk.statt St. Martin vorbeikommen.
Was die Hände wissen
In einem Masterlehrgang den Blick schärfen und öffnen für alte Räume, Materialien, Arbeitstechniken.
In einem Masterlehrgang den Blick schärfen und öffnen für alte Räume, Materialien, Arbeitstechniken.
Von MuseumPasseier
„Unterschiedliche Menschen, Materialien und Handwerke treffen und verknüpfen sich um Neues zu schaffen”, so beschreibt eine Absolventin des Masterlehrganges „Konzeptuelle Denkmalpflege“ die Ausbildung, die Hand, Kopf und Herz vereinen will. Der länderübergreifende Studiengang ist berufsbegleitend, für Menschen mit oder ohne Matura, dauert fünf Semester und läuft über die Donau-Universität Krems (A).
Schwerpunkt des Studiums ist das Praktisch-Gestalterische: Sich nachhaltig, einfühlsam und fachgerecht mit historischer Bausubstanz und handwerklichem Kulturerbe auseinandersetzen sowie Wahrnehmung, Wissen und Wirkungen in Bezug auf Materialien, Formen und handwerkliche Techniken untersuchen.
Start des Studienganges ist Winter 2022/23, die Unterrichtsorte sind die Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair (CH), die BASIS Vinschgau in Schlanders und – neu seit 2022 – auch das MuseumPasseier. Zudem ist seit heuer das Landesdenkmalamt der Autonomen Provinz Bozen Südtirol offizieller Kooperationspartner.
Die Studienplätze sind auf maximal 14 Personen begrenzt. Die Webseite www.vereinkonzeptuelledenkmalpflege.it bietet einen guten Einblick in das Tun der Studierenden sowie den Kontakt für Fragen und Bewerbungsgespräche.
Andenken an die lieben Verstorbenen
Zur Geschichte der Sterbebilder.
Zur Geschichte der Sterbebilder
Von Elisa Pfitscher
Totenbild, Totenzettel, Sterbebild, Trauerbild oder auch Trauerzettel. Viele Bezeichnungen für denselben Brauch innerhalb der europäisch-katholischen Kultur. Die Verteilung von Sterbebildern, welche anfangs noch handgeschriebene Totenzettel waren, erfolgte bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts im Gebiet der heutigen Niederlande. Zunächst nur Wenigen vorbehalten und als aufwendige Kupferstiche produziert, erreichte die Herstellung und Verteilung von Sterbebildern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Bayern und Tirol.
Das älteste dem Museum gehörende Sterbebild stammt aus dem Jahre 1845. © MuseumPasseier
Elisabeth Jenewein aus St. Martin starb im Juni 1845. © MuseumPasseier
Kein Geistlicher und vor allem: kein Mann! Das älteste Sterbebild aus dem Passeier, welches im Museum erhalten ist, ist einer von Lueg am Fuße des Prenners stammenden Frau, welche in St. Martin verheiratet war, gewidmet. Elisabeth Jenewein war als Gross-Tabaktraffikantin des Krämerladens wahrscheinlich keine Unbekannte im Dorf. Sie führte nach dem Ableben ihres ersten Mannes Karl Amort den Laden weiter und heiratete ein zweites Mal den aus Rabenstein gebürtigen Johann Ennemoser. 1845 verstarb sie mit 46 Jahren. Gewiss gibt es noch ältere Sterbebilder aus dem Passeier, wie jenes aus der Sammlung von Harald Haller, welches aus dem Jahre 1838 stammt und, wie das von Elisabeth Jenewein, ein umfunktioniertes, auf der Rückseite bedrucktes Andachtsbild ist. (Dorfbuch St. Leonhard in Passeier, Band 1 “Geschichte und Gegenwart” 2000, S. 351)
Ursprünglich wurden sie im Gebetsbuch aufbewahrt, um immer wieder an die Verstorbenen erinnert zu werden. Allzu oft fallen sie einem gar nicht mehr auf und gehören zum Inventar wie das Kreuz an der Wand: Die Sterbebilder findet man bei uns üblich in der Stube, in einer Ecke oder im Herrgottswinkel aufgestellt, an den Leisten des Getäfels geheftet oder um das Waichprunninkriëgl aufgereiht. Irgendwann landen sie in einem Schuhkarton, weil es im Laufe der Jahrzehnte zu viele geworden sind und aus Pietätsgründen nicht weggeworfen werden. Bei besonders nahen Menschen, welche verstorben sind, verwandelt sich jener Ort, an dem die Sterbebilder platziert sind, nicht selten zu einem kleinen Altar: Geschmückt mit Rosenkranz, Blumen, Kerzen und dergleichen bleiben die lieben Menschen ständig präsent und geraten nicht in Vergessenheit.
Der sein junges Leben für Führer, Gott und Heimat zum Opfer brachte. Der Umstand, dass in den Kriegen viele junge Männer fielen, welche nicht in ihrer Heimatgemeinde überführt und bestattet werden konnten, führte dazu, dass die Totenzettel das einzige für Familie und Bekannte waren, was an den Gefallenen oder Vermissten erinnerte. Angaben zum Rang der Männer innerhalb der Armee waren stets vorhanden. Obergefreiter und Panzerjäger Alois Gufler findet auf dem Sterbebild seiner Mutter im Jahr 1959 Platz, da er nach dem Krieg nicht mehr Heim gekommen war und seine letzte Nachricht bereits über 15 Jahre zurück lag. Auch erst nach vielen Jahren wurde der Vermissten auf einem Grabstein gedacht. Bei anderen Opfern des Krieges ist der letzte Aufenthaltsort zu lesen, sowie oft sogar der Umstand des Todes. Diese Praxis zu Zeiten des Krieges trug maßgeblich dazu bei, dass das Sterbebild auch heute noch als Erinnerungsbild dient.
Sebastian Pfitscher: Er fand den Tod an der Grenze zum heutigen Russland und nur das Sterbebild dient in der Heimat als Erinnerung. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier
500 Tage Ablaß, monatlich vollkommener. Anders als die Ansprache bei der Beerdigung, welche sich mit dem vergangenen Leben der verstorbenen Menschen befasst, richtete sich der Totenzettel ursprünglich an die Zeit nach dem Ableben, an das Jenseits. Der Sterbezettel war bis vor einigen Jahrzehnten mit der Bitte versehen, für das Seelenheil der Toten zu beten und mithilfe der sogenannten Ablassgebete ihnen den Weg durch das Fegefeuer zu erleichtern und zu verkürzen, welcher aufgrund der irdischen Schuld zu verrichten ist. Bis zur Reformation nach dem zweiten vatikanischen Konzil in den 1960ern, waren die Kärtchen mit diesen Ablässen zugunsten der Verstorbenen versehen.
Fast immer waren die Karten mit einem Ablass und den Namen der Druckereien versehen. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier
Interessante Entwicklung in ihrer künstlerischen und inhaltlichen Form der Sterbebildchen. Ältere Kärtchen halten sich grundsätzlich an wenige Regeln, denn ihre Formen weichen stark von der heutigen einheitlichen Form ab. Wie Werner Ollig und Werner Thaler im Montaner Sterbebilderbuch ausführlich beschrieben haben, wurde anfänglich auch bei uns im Kupferstichdruck produziert, ab 1840 im neuen Stahlstichdruckverfahren. Bis in die 1960er war es zunächst üblich, dass Heiligen- und Andachtsbilder, welche in großen Druckereien gefertigt wurden, zu Sterbebilder umfunktioniert wurden, indem auf die Rückseite der Nachruf für den Verstorbenen von einer kleineren Druckerei in der näheren Umgebung gedruckt oder handschriftlich angebracht wurde. Der Name der Druckerei war meist am unteren Rand der jeweiligen Seite genannt.
Von den gewöhnlichen schwarz-weißen Motiven zu verspielten Ton in Ton Abbildungen. Seit 1860 gebrauchte man die Lithografie, den Steindruck für die Herstellung der Kärtchen. 20 Jahre später konnten die Bilder bereits mithilfe der Chromlithografie erstmals in Farbe gedruckt werden, damals aber fast ausschließlich nur die Bildseite. Ab der gleichen Zeit versah man die Karte mit einem Foto der Verstorbenen, zunächst sorgfältig zugeschnitten und anschließend in die dafür vorgesehenen Felder geklebt. Mit der Zeit nahm das Abbild des Verstorbenen immer größeren Platz ein. Fast alle Sterbebilder weisen eine schwarze Umrandung auf, den Trauerrand.
Hinter dem Brauch steckt nach wie vor die Tragik des Todes. Oft dauerte es eine Weile, bis das fertige Sterbebild in der Heimatgemeinde unter Familie und Freunde verteilt werden konnte. Es ergab sich so, dass sich auf einem Kärtchen gleich mehrere Personen befanden, welche in der letzten Zeit aus derselben Familie verstorben waren. So findet man auf einigen Kärtchen bis zu vier Verstorbene. Exemplarisch hierfür ist das Sterbebild der Familie Tribus vom Obergrafeishof im Gemeindegebiet von St. Leonhard. Bei einem Murenabgang im Juli 1940 kamen drei der vier Familienmitglieder ums Leben. Nur die Tochter überlebte das Unglück in dieser fürchterlichen Nacht.
Der tragische Fall der Familie Tribus von Obergrafeis in St. Leonhard, welche in der Nacht vom 03. Juli 1940 von einer Mure überrascht und getötet wurde. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier
Ein Anstoß, damit sich das Rad der Erinnerung dreht. Für die Nachwelt besonders bedauerlich ist die Kürzung der Informationen auf der Sterbekarte: Die heutigen Sterbebilder geben neben dem Namen und dem Sterbedatum, einem Foto und einem frommen Spruch, nicht viel Auskunft über das Leben und Ableben des verstorbenen Menschen. Diese wenigen Zeilen, oft versehen mit einer Beschreibung der Persönlichkeit und den Umständen des Todes, machen den Blick in die Vergangenheit besonders lebhaft. Mit einigen Informationen lässt sich viel erahnen und so mancher kann sich nach einem kleinen Gedankenschubs an die Momente, als man von dem Tod des oder der Bekannten hörte, erinnern.
De mortuis nihil nisi bonum - Über Tote spricht man nur gut: So waren die Beschreibungen der Verstorbenen auf den Kärtchen immer etwas gnädig formuliert: Der Verewigte war ein vorbildlicher Gatte und Familienvater; Sein Leben war Wohltun und rastlose Arbeit; Gebet und Kirchenbesuch war für ihn selbstverständlich; In der Gemeinde war er hochgeachtet und sein Leben war geprägt von seinem ausgezeichneten Geschäftssinn… © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier
„Zur frommen Erinnerung im Gebete“. Heute steht anstelle des Gebetes häufig ein Gedicht oder ein bekanntes Zitat. Die Fotos wurden größer, aus Platzmangel wurden es faltbare Doppelblätter. Statt frommer Motive wie Christus am Kreuz und die betende Madonna sind Kunstdarstellungen und landschaftliche Motive zu sehen.
Oft verwendete Motive bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier
Einen festen Platz in der Gesellschaft. Wenn sie auch eine immense Veränderung innerhalb der letzten 150 Jahre durchgemacht haben, so behalten Sterbebilder immer noch einen festen Platz im Ritual der Verabschiedung eines Dahingeschiedenen. Sie sind für die Beschäftigung mit der Geschichte unerlässlich und nicht weniger bedeutsam für die Ahnenforschung. Wie lange es sie noch geben wird, ist unklar. Denn mittels Digitalisierung finden viele alte Traditionen ein Ende. Das Durchwühlen von alten Sterbebildern garantiert jedoch, dass man sich in vergangene Zeiten begibt und ein wenig nostalgisch und ehrfürchtig wird.
Der Wifling in der Badewanne
Von einem der auszog, um gewaschen zu werden.
Von einem der auszog, um gewaschen zu werden.
Von Judith Schwarz.
Fotos: Rita Graf
Möglichst nicht waschen! So lautet die Devise von Trachtenexpert*innen in punkto Wiflingkittel. Als Wifling bezeichnet man einen groben Stoff aus Schafwolle mit Kettfäden aus Leinen oder Seide. Ein Trachtenrock aus eben diesem Wifling ist ein unglaublich schweres Ungetüm aus vielen Metern Gewebe, das Frauen einst auf ihren Hüften trugen bzw. wohl mehr schleppten. Typisch für den Wiflingkittel sind die Stehfalten, die aus dem eh schon dicken und steifen Stoff ein Koloss an Kleidungsstück machen.
Daher hat man wohl ein walzenartiges Stück von einem Wesen, aber kein Weib, erklärt 1852 ausgerechnet der Priester Beda Weber seine Ansicht über die Passeirerinnen im dunklen Wollrock. Abgesehen von der mangelnden Weiblichkeit beklagt er auch die fehlende Reinlichkeit in Bezug auf Kleidung: "Der Schmutz legt sich durch unmäßig langen Gebrauch so tief hinein, daß er ganz schwarz aussieht". Wobei wir beim Thema wären.
Darf man Museumsobjekten den Schmutz der Jahrhunderte einfach abwaschen? Den Straßenstaub und Alltagsdreck, den Schweiß und Urin? Möglicherweise schwänzt man damit auch die Aura des Objekts in den Abguss? Oder, wenn nicht die Aura, dann zumindest den typischen Geruch. Da wir erste Spuren von Mottenbefall an unserem Wiiflingkiitl bemerkten, entschieden wir uns, auf Aura und Geruch zu verzichten, dafür aber den Stoff zu retten. Und so nahm Museumsmitarbeiterin Rita den “Weiberrock” für ein Wochende mit nach Hause.
Wir meinten, wir hätten einen schwarzen Kittel. Nach dem Waschen stellten wir fest, er ist rötlich-dunkelbraun. Insgesamt hat er die Behandlung mit Schmierseife und Essigwasser in Ritas Badewanne gut überstanden. Und unsere Befürchtungen zerfielen wie Mottenfraß: Das dunkle Gewebe aus Schafwolle war intakt geblieben und plötzlich wieder wollweich, der helle Innensaum hatte sich nicht verfärbt, die roten Kettfäden aus Leinen hatten gehalten. Rita ließ also erleichtert die dunkelbraune Soße, in der unser Stoffmonster geschwommen hatte, aus ihrer Wanne.
Schmutz und Geruch des Wiflingkittels schwimmen im Badewasser. © Rita Graf/MuseumPasseier
Möglichst nicht waschen! ermahnte uns einige Liter Abtropfwasser später ein Trachtenschneider aus St. Martin, den wir vor der Badewannenmission telefonisch nicht erreicht hatten. Während der vollgesaugte Wifling an sein Bad (womöglich das erste in seinem Leben) zurückdachte und gemütlich vor sich hin tröpfelte, erzählte uns Hansjörg Götsch, über den besonderen Stoff und was es mit der Kombination Wasser und Wifling auf sich hat.
Hier eine Zusammenfassung aus dem Gespräch mit Hansjörg Götsch, Jg. 1944:
Der Wiflingstoff wurde auf dem Webstuhl handgewebt. Die Kettfäden, das sind die, die endlos lang sind, die sind aus Seide. Purpurfarbene Seide. Der Schuss, das sind die Querfäden, der ist aus Wolle.
Es hat früher einen eigenen Markt für Wiflingstoff gegeben, im Ötztal glaube ich. Ich kann mich aber auch erinnern, dass mein Vater und andere Männer immer vom Wiflinghandel gesprochen haben. Wenn sie zum Haareschneiden oder Rasieren gekommen sind, habe ich das Wort oft aufgeschnappt.
Das waren die 1950er Jahre. Und das waren Männer, die selber nicht Stoff gekauft haben. Ob es zu der Zeit noch den Wiflinghandel gegeben hat, weiß ich nicht. Sie haben es wohl meist als Witz gemeint, so als Spruch. Vielleicht war es so gemeint: Wenn man auf den Wiflinghandel gehen konnte, dann hatte man Geld.
Ganz sicher hat sich nicht jede Frau einen Wiflingkittel leisten können. Das waren vor allem die angesehenen Bäuerinnen, die gut situiert gewesen sind. Auf Baumkirch in St. Martin beispielsweise hatte man zwei solche Kittel, auf Steinhaus auch. Aber ganz viele Kittel waren nicht vorhanden. Diese Wiflingkittel sind zur Zeit der Weltkriege abgekommen, als kein Wohlstand mehr war. In den 1950er Jahren weiß ich nur mehr die Marketenderinnen, dass die einen getragen haben, wenn sie halt mit der Musikkapelle ausgerückt sind.Dass die Frauen sich so dick ausstaffiert haben, verstehen wir heute nicht mehr. Das ist wohl vergleichbar mit den Adeligen, die früher ein besonderes Gestell hatten, damit die Frauen um die Hüfte fülliger ausschauten. Was die alles für ein Zeug anhatten! So ähnlich ist es bei unserem Miederleibchen gewesen. Das Miederleibchen hatte am unteren Ende eine richtige Wurst aus Stoff angenäht. Und daran wurde der Kittel aufgehängt. Diese Wurst war eine Art Auflage, damit der Kittel gehalten hat.
Die Männertracht und Männerkleidung hat der Schneider gemacht. Das Zeug für die Weiberleit, das haben meistens nicht die Schneider gemacht, sondern die Schneiderinnen.
Die “Nooterinnen” – das Wort haben zu unserer Jugendzeit noch alle benutzt – das waren die Schneiderinnen. Der Schneider war immer der Schneider, die Schneiderinnen waren die “Nooterinnen”. Warum man den selben Beruf bei Männern und Frauen anders genannt hat, weiß ich auch nicht. Meist gingen die Schneider und “Nooterinnen” auf die Stör. Meine Großmutter war eine “Nooterin”, sie hat es von ihrer Mutter gelernt.
Ich vermute, dass die “Nooterinnen” früher nur eine Rocklänge gemacht haben. Ob die Frauen überhaupt vorher gekommen sind zum Probieren, weiß ich nicht. Außer jemand konnte nach Maß bestellen. Man hatte wahrscheinlich nur eine Rocklänge gemacht: Bei einer großen Frau war der Rock dann halt zu kurz, bei einer kleinen Frau zu lang. Das sieht man auch auf den alten Fotos.
Bei diesem Wiflingkittel ist die Naht teilweise von Hand genäht, und zwar sehr schmal gestochen, ein Teil ist mit der Maschine gemacht. Den dicken Teil musste man von Hand nähen, früher hätte das keine Nähmaschine geschafft. Ein Teil, der unter dem Schurz versteckt ist, ist später mal geflickt worden. Alles mit Hinterstich. Man hat früher einfach viel mehr gespart mit dem Stoff. So viel wegschmeißen, wie wir heute tun, das ist früher einfach nicht gegangen. Es gibt zwei Aufhänger, eventuell hat man den Kittel einfach damit im Raum aufgehängt.
Der Wiflingkittel ist nie gewaschen worden, da bin ich mir sicher. Aber wenn er nass geworden ist, vom Regen oder so, dann haben die Falten nicht mehr richtig gehalten. Dann musste man die Falten wieder einziehen. Ich selbst habe das Falten-Einziehen nie gemacht, ich weiß halt, dass man es früher gemacht hat.
Zum Beispiel, wenn Marketenderinnen zu einem Umzug – meinetwegen aufs Oktoberfest – gefahren sind. So in den letzten 1950er Jahren und anfangs der 1960er sind sie sicherlich nach München hinaus. Die haben bei solchen Ausflügen ja nur dieses eine Gewand angehabt. Sie haben es hier angezogen, sind hinausgefahren und nach dem Umzug dann wieder herein. Oder sie haben draußen übernachtet. Wenn es vom Regen platschnass geworden ist, dann mussten sie vor dem Schlafengehen noch die Falten einziehen. Sonst hat der Kittel morgens ja ausgeschaut, so ohne Falten!
Der Faden wird mit einer Nadel quer durch die Falten eingezogen. Zuerst etwas unterhalb der Taille, dann in der Mitte und dann nochmal ganz unten am Rockende. Dann wird der Kittel gepresst und wenn die Falten dann am nächsten Tag wieder richtig halten, dann hat man den Faden wieder rausgezogen.
Ergänzung vom 22. September 2022:
Unserem frisch gewaschenen Wiflingkittel wurden mittlerweile wieder Falten gemacht. Hansjörg Götsch hat sie eingezogen und wir werden uns hüten, den Kittel nochmal in die Nähe von Wasser zu lassen. Ehemalige Marketenderinnen aus Passeier, die noch Wifling-Trachtenröcke getragen haben, haben wir bis dato keine gefunden.
Petit chapeau
Ein Hut mit zwei Spitzen und vielen Fragezeichen.
Awäck as wië a Huat, sagen die Passeirer*innen, wenn etwas oder jemand abrupt verschwindet. Dieser Hut hingegen ist plötzlich im Depot aufgetaucht, und zwar ist er unserem Museumspraktikanten Lukas in die Hände gefallen, was ihn zu einigen Recherchen veranlasst hat. © MuseumPasseier
Ein Hut mit zwei Spitzen und vielen Fragezeichen.
Von Lukas Ennemoser
Vor kurzer Zeit, als ich im Museum arbeitete, kam mir ein interessanter Hut unter. Die Kopfbedeckung erweckte sogleich meine Neugier und ich begann mich zu fragen, welchen Weg so ein Hut etwa hinter sich haben könnte. So begann die Reise meiner Nachforschung.
Beim Hut handelt es sich um einen Zweispitz, ähnlich jenem des Napoleon. Diese Hutform war sehr beliebt zwischen 1790 und 1820, besonders bei Adeligen und Beamten. Der Zweispitz entwickelte sich aus dem Dreispitzhut und löste diesen nach und nach ab. Auch im Militär fand der Zweispitz bald seinen Platz, was die Unterscheidung zwischen Aristo- bzw. Bürokratenhut und Offiziershut schwierig macht. Einzig die Verzierungen konnten einen Unterschied ausmachen, so hatten beispielsweise Offiziere des öfteren Schmuck wie Kokarden (kreisrunde Abzeichen) oder Knöpfe auf ihren Zweispitzen.
Auch der Zweispitz des Museums hat eine Kokarde und sogar Straußenfedern. Daraufhin habe ich mich prompt bei mehreren Museen umgehört, unter anderem beim Deutschen Hutmuseum Lindenberg. Sogar diese meinten, dass diese Art von Hüten meistens von Staats- und Stadtbeamten getragen wurden. Daraus würde sich schließen lassen, dass auch der ehemalige Besitzer unseres Zweispitzes einen solchen Stand gehabt haben sollte. Das Hutmuseum teilte mir außerdem noch mit, dass die Beamtenuniform von damals eine Synthese zwischen Bürgertum und Militär darstellte.
Wem gehörte nun dieser Zweispitz? Der Hut ist dem Museum einst von einem Meraner im Auftrag der Hutbesitzerin überbracht worden: Er soll aus dem Nachlass einer ihrer Vorfahren stammen, den Meraner Bürgermeistern Franz Putz (1824-1894) oder Gottlieb Putz (1818-1886). All dies deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich stimmte, dass Beamte diesen trugen.
Ein Herrenhut aus schwarzem Filz mit Straußenfedern und blau-rot-gelber Kokarde. Wer wird ihn einst stolz auf dem Kopf oder lässig unterm Arm getragen haben? © MuseumPasseier
Abbildungen der Bürgermeister Putz mit Zweispitz habe ich keine gefunden. Aber sicherlich gibt es Beispiele, welche untermalen, dass der Zweispitz für Beamte bzw. hohe Standespersonen bestimmt war. Also begab ich mich auf die Suche nach Zweispitzträgern. Als Historiker in spe bezog ich mich natürlich auf alte Bildnisse und besuchte die Datenbank Tiroler Porträts. Nach langem Scrollen und dem Anschauen von 3000+ Abbildungen war mein Fund ein ernüchternder. Allerdings habe ich bei der Durchforstung sehr viele super gezeichnete Bilder gefunden. Aber um zurück zum Punkt zu kommen: Es gibt zwei Kandidaten, welche mit einem potentiellen Zweispitz auf dem Kopf dargestellt sind: Johann Florian de Inama und Johann Michael Lachmüller von Hofstatt und Gravötsch.
Kein Hinweis auf den Huthersteller im violetten Innenfutter. Aber der geringe Durchmesser verrät etwas über den Hutbesitzer: Er hatte keinen allzu großen Kopf. © MuseumPasseier
Wieso fand dieser Hut nun den Weg ins MuseumPasseier? Wie bei vielen Objekten ist dies ein ungeklärtes Phänomen, jedoch spekuliere ich, dass die ehemalige Besitzerin sich dachte: „Französischer Hut? Andreas Hofer hatte ja auch irgendwas mit Franzosen zu tun, das passt schon!“ So oder so, dieses Museum ist seitdem um einen Zweispitz reicher, was nicht jedes behaupten kann. Ich persönlich beschwere mich darüber gewiss nicht!
Little Hofer
Ein Tabletopper plaudert aus dem Modellbaukästchen.
Andreas Hofer als Spielfigur. Foto: David Hofer
Ein Tabletopper plaudert aus dem Modellbaukästchen.
Von David Hofer
Es gibt heutzutage viele Hobbys, denen man nachgehen kann. Ich persönlich habe mich in meiner Innsbrucker Studienzeit für eine eher exotische Variante entschieden, wobei es unterschiedliche Bezeichnungen dafür gibt: Tabletop, Miniature Wargaming oder Mandlr såmmln. Außenstehenden kann man dieses Hobby am ehesten mit den Begriffen Zinnsoldaten – Modellbau – Schach erklären. Diese Freizeitbeschäftigung besteht aus Sammeln, Basteln, Malen und auch dem Spielen von Partien.
Üblicherweise werden Figuren als Bausätze bestellt, zusammengebaut und dann bemalt. Die Figuren bestehen neben Metall inzwischen aus Hartplastik, Resin (Kunstharz) und anderen Materialien. Neueste Entwicklung ist der moderne 3-D Drucker für den Haushalt, womit man sich die Figuren selber zuhause drucken kann. Hobbybegeisterte möchten die Figuren auch einsetzen und in einer Art Strategiespiel werden historische Auseinandersetzungen nachgestellt und das eigene taktische Geschick überprüft. Sehr beliebt ist dabei die sogenannte Franzosenzeit, also der Zeitraum Andreas Hofers.
Figuren des Tiroler Landsturms mit Heugabeln hinter selbstgebastelten Barrikaden. Link zum Originalbild
Es gibt mehrere verschiedene „Settings“ für dieses Produkt. Ob Antike, Mittelalter, Neuzeit oder Moderne, man wird Miniaturen und Zusatzmaterialien dafür finden. Gerade die Auseinandersetzung mit den jeweiligen geschichtlichen Begebenheiten machen zu einem großen Teil die Faszination dieses Hobbys aus. Ich persönlich habe in meiner Sammlung größtenteils spätmittelalterliche Figuren, ergänzt mit einigen fantastischen und mythologischen Elementen (wer kann schon einem Drachen widerstehen?).
Die Ära Napoleons gehört zu den populärsten Produktlinien. Bis heute denkt man bei Zinnsoldaten üblicherweise an die uniformierten französischen Truppen mit den großen Hüten. Zusätzlich hat dieser Zeitraum den Vorteil, dass es eine große Anzahl verschiedener Mächte gab, die an den Konflikten beteiligt waren und sich dadurch historisch korrekt abbilden lassen. Das historisch akkurate Darstellen ist ein gewichtiger Punkt. Es gibt Erzählungen, wie Leute dafür streng gerügt wurden, die Epaulette (Schulterbesatz einer Uniform) im falschen Farbton bemalt zu haben.
Tiroler Schützen, von Hand bemalt. Link zum Originalbild
Und wo passt hier nun der Andreas Hofer hinein? Da zahlreiche Hobbyisten und Hersteller leidenschaftliches Interesse für Napoleons Zeit haben, gibt es dazu sehr viele verschiedene Produkte. Unter anderem eben auch Figuren für Andreas Hofer und Tiroler. So ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass zwei US-Amerikaner an einem verregneten Nachmittag vielleicht das zweite Gefecht am Berg Isel nachstellen. Dafür brauchen sie Gelände, Miniaturen und Spielregeln. Größtes Problem beim Tiroler Volksaufstand, so entnimmt man es den Hobbyforen, ist dabei die authentische Darstellung des steilen Geländes.
Ein Gefecht des Tiroler Volksaufstands wird in den USA nachgespielt. (Link zum Originalbild und zu weiteren Fotos)
Den Andreas Hofer und die Tiroler gibt es von mehreren Herstellern. 2009, passend zum Gedenkjahr zu 1809, kam erstmalig eine Andreas Hofer Figur auf dem Markt. Überraschenderweise war Australien der Herkunftsort, wohl noch ein britisches Erbe. Sozusagen dr Andr von Down Under.
Der Andr vom Down Under – neben Josef Speckbacher. (Link zum Originalbild)
Selbstverständlich hat das Mutterland des modernen Miniaturenschmiedens nachgezogen und es gibt ebenso einen Andreas Hofer aus dem Vereinigten Königreich.
Der Andreas Hofer aus dem Vereinigten Königreich. (Link zum Originalbild)
In naher Zukunft wird es einen Andreas Hofer „Made in Germany“ geben. Über Crowdfunding finanziert versucht der Hersteller passende Miniaturen zu entwerfen. Dass Gemälde Vorlagen sein können, zeigen bereits diese Truppen aus dem Bild zu einem Gefecht bei Wörgl in Nordtirol.
Neue Tiroler aus Deutschland in Entstehung, bisher wurde nur an den Bayern gearbeitet. (Quelle: Pianowargames/Facebook)
Interessant zu lesen sind die Foren-Diskussionen der Hobbyisten. In diesen tauschen sich die Hobbyisten darüber aus, mit welchen Spielregeln sie Andreas Hofer und die Tiroler darstellen können. Gut durch das Gelände sollen sie sich bewegen können. Einen Bonus im Kampf gegen die Bayern erhalten. Und sehr tapfer sein. Dafür aber keine zu geordneten Schlachtordnungen und Formationen.
Ich persönlich besitze keine der offiziellen Tiroler-Figuren. Aber nach meiner Zeit in Innsbruck bekam ich von einem Freund eine von ihm gebastelte Miniatur. Dafür hat er verschiedene Teile aus passenden Gussrahmen kombiniert, um einen eigenen und einmaligen Andreas Hofer zu erschaffen. Und dazu gab es noch einen Trupp Tiroler von 1809, ebenfalls aus diversen Bausätzen selbst gebastelt.
Der Andreas Hofer und die Tiroler aus meiner eigenen Sammlung. Foto: David Hofer
UPDATE | 2. Dez. 2022
Mittlerweile steht das Design für “The Alps Aflame. The Tyrolean Rebellion of 1809” und die Crowfunding-Kampagne für die Produktion von 180 Figuren ist gestartet.
UPDATE | 30. Jan. 2024
Wir haben nun einen Tyrolean Captain aus dem 3-D-Drucker! Herzliches Danke an David, “Little Hofer” bekommt bald einen Platz in der Hoferausstellung.
Der Hofer aus der Serie “The Alps Aflame. The Tyrolean Rebellion of 1809”. Foto: MuseumPasseier
UPDATE | 12. Feb. 2024
Little Hofer ist jetzt farbig.
Der Hofer aus der Serie “The Alps Aflame. The Tyrolean Rebellion of 1809”. Foto: David Hofer
“Es grüßt dich dein Koat”
Zwei Passeirer Verliebte versuchen sich 1937 im schriftlichen Liebesdialog.
In einem Passeirer Haushalt findet sich über Jahrzehnte aufbewahrte Liebespost. © Alexa Pöhl/MuseumPasseier
Als sich die Bauerntochter B. und der Taglöhner S. köstliche Liebesbriefe schrieben.
Von Judith Schwarz
Sie war die Tochter eines angesehenen und strengen Bauers und Tischlers in Passeier. Er ein einfacher Taglöhner, der sich Zeit seines Lebens auf verschiedenen Höfen verdingte. Sie kannten sich flüchtig von Kindesbeinen an und irgendwann muss es gefunkt haben.
Ihre heimlichen Treffen im Viehstall flogen natürlich auf. Und gleichzeitig flogen wohl auch die Fetzen: Der bestimmende Vater, der sich um die Zukunft seiner Tochter sorgte. Die verliebte Tochter, der es egal war, ob der Auserwählte ihr ein Dach über dem Kopf würde bieten können. Und der nicht minder verliebte junge Mann, der wusste, dass er schon bald von seiner Liebsten getrennt sein sollte.
1936 hatte S. seinen Militärdienst anzutreten. Es verschlug ihn nach Mailand und bis er seine geliebte B. wiedersehen sollte, vergingen einige Monate. Wir wissen nicht, wann und wie ihr Briefeschreiben begonnen hat, aber es haben sich acht Briefe und Postkarten in fein säuberlicher Schrift erhalten. Der früheste datiert mit 2. Juni 1937, der späteste wurde am 19. Dezember 1937 geschrieben. Dazwischen liegen sechs Monate, in denen sich S. und B. wahrscheinlich nicht gesehen haben.
„An meinen Gelübten“, schreibt B., und auch über ihre intensiven Gefühle. Was war überhaupt sagbar in jener Zeit? Bzw. schreibbar?
U[nd] ich errinere mich so Sonntags
in der Kirche wenn ich herunter
schau auf deinen gewissen Platz.
Da brennt mir das Herz vor Sehnsucht.
Wie beschreibt man seine Sehnsucht? Einfacher, als darüber in ausführlichen Briefen zu schreiben, ist es, Bildpostkarten zu schicken. Und deren bunte Sehnsuchtsmotive sprechen zu lassen.
O die Sehnsucht
nach dir ach könnte ich nur eine
halbe Stunde bei dir sein.
Ich kann es gar nicht
sagen noch schreiben
wie Lieb ich dich hab.
Die Liebe blüht wieder auf: Auf kolorierten Bildpostkarten versuchen sich zwei Passeirer Verliebte im schriftlichen Beziehungsdialog. © Alexa Pöhl/MuseumPasseier
Schreiben aus und über Liebe ist das Eine. Das Andere ist die Angst, beim heimlichen Briefeschreiben entdeckt zu werden. Und die Sorge, dass die Verbindung von der Familie nicht anerkannt wird. Später soll der Brautvater es aufgegeben haben, sich in die Männerwahl seiner Töchter einzumischen.
Liebster S., ich mus dir
noch etwas schreiben, der Vater
hat noch nie ein Wort gesagt
zu mir von dir aber sonst ist
er heuer fein er war nicht oft
so fein ich habe kein schlechtes
Wort gehört es ist nicht wie
voriges Jahr. bitte wenn du
einmal Zeit hast schreib ihn
einmal schauen ob er gar nichts
sagt.
B. zeichnete in ihrer Schlafkammer blaue Blumen für ihren Liebsten, heimlich und bei Kerzenschein: Ich setze so im stillen Kämerlein verlassen von dir. © MuseumPasseier
Köstlich sind die Schlussformeln der Liebeskorrespondenz. Dein Koat, schreibt B. einige Male an ihren S., als er beim Militärdienst weilt und sie sich daheim derlångwailt. Wobei Koat, laut Franz Lanthaler, eigentlich ein Schimpfwort ist und von einem lästigen Insekt bis zu einem großen Untier alles bezeichnen [kann], was als grauslich oder unansehnlich eingestuft wird.
Jetzt mus ich Schlafen
gehen es ist schon bald
zwölf Uhr, es grüst dich
dein Koat.
Nicht immer scheint die Liebeskorrespondenz als Brücke der Kommunikation funktioniert zu haben. Im letzten erhaltenen Brief klingt Besorgnis durch.
Habe noch keine Post
von dir bekommen als
zuletzt die Karte und
auf der hab ich dir
Antwort geschrieben weis
nicht hab ich dich
beleidigt oder was ist
Müssen wir uns Sorgen machen? Wird die Fernbeziehung halten, der Bräutigam heil zurückkommen, der Brautvater sein Einverständnis zur Heirat geben? Alle drei Fragen können wir bejahen: S. und B. werden einige Jahre nach dem Militärdienst heiraten, ein gutes Dutzend Kinder bekommen und im hohen Alter sterben. Ihre Liebesbriefe aber haben ihre Ehe überdauert.
Hast du auch Liebesbriefe deiner Vorfahr*innen? Briefe aus einer Zeit, bevor Textnachrichten, Audiokommentare oder Emojis verschickt wurden? Wir freuen uns, wenn du sie uns schickst oder uns davon erzählst.
Guck, ein Nepomuk!
Von den vielen Heiligen fasziniert einer besonders. Der mit dem markanten Namen.
Er scheint mit skeptischem Blick das Wasser im Zinnkesselchen zu bewachen: Der Näppermukk auf dem Weihwasserkrügl von Anna Ladurner Hofer. © MuseumPasseier
Von den vielen Heiligen fasziniert einer besonders: Der mit dem markanten Namen.
Von MuseumPasseier
Im Passeier wird aus dem heiligen Johannes Nepomuk meist der Näppermukk – damit klingt der Märtyrer mit dem etwas speziellen Nachnamen gleich weniger exotisch. Fast so, als spräche man über einen liebenswerten, alten Kumpel. Dass der Näppermukk eigentlich Johannes Wölfflin hieß, steht zwar auf Wikipedia, wissen aber wenige. Und dass es im heutigen Tschechien eine Stadt mit dem ehemaligen Namen Pomuk gibt, ebenso. „Ne Pomuk“ bedeutet „aus Pomuk“ – und damit ist klar, wie Johannes Wölfflin zu seinem Namen gekommen ist, der also gar kein Nachname ist.
Über den Nepomuk aus Pomuk und die Nepomuks in Passeier handelt eine neue Passeirer Publikation. Monika Mader hat sich intensiv mit dem Märtyrer beschäftigt, den man als Beschützer vor Wassergefahren und als Schutzheiligen der Priester und des Beichtgeheimnisses kennt. Gemeinsam mit Katrin Klotz und Werner Graf berichtet sie auf 150 Seiten über die 200-jährige Geschichte der Kirche zum Heiligen Johannes Nepomuk in Wans in Walten, Gemeinde St. Leonhard in Passeier.
Der Star der Publikation ist aber Johannes Nepomuk. Das liegt an einem Ritual, das in Walten jährlich im Juni Teil der Johannes-Prozession ist und wie ein Leichenzug bei einem Begräbnis anmutet. Eine lebensgroße Holzfigur des toten Nepomuk wird auf einer Bahre aus dem Waltnerbach geborgen (nachdem sie am Morgen dort hinein gelegt worden ist) und zu Fuß etwa 3 km zum Wånser Kirchl getragen. Ein eigenartiges und auch einzigartiges Schauspiel.
Daneben enthält das Buch eine Kollektion an Nepomuks aus Passeier. Die Gemälde, Fresken und Skulpturen, die die Künstler der Passeirer Malerschule geschaffen haben. Dazu natürlich auch Bildstöcke, von denen aus der dargestellte Nepomuk die Landschaft vor Wasserfluten schützen sollte. Und dann ist darin auch der Nepomuk auf einem Weihwasserkrügl abgebildet, das im MuseumPasseier hängt. Ein ganz spezielles Objekt.
Der Wandkessel aus Zinn trägt die Initialen ALH. Dass es das Weihwasserkrügl der Anna Ladurner Hofer war, liegt nahe. Die Sandwirtin und Ehefrau von Andreas Hofer hat sehr gerne ihren Besitz gekennzeichnet bzw. vielmehr kennzeichnen lassen, sie war ja Analphabetin. So finden wir ihren Namen auf gar einigen Möbelstücken.
Warum ein Weihwasserkessel mit dem Johannes Nepomuk? Das Motiv ist für einen Weihwasserkessel selten, obwohl die Lebensgeschichte des Johannes Nepomuk mit Wasser zu tun hat: Er selbst konnte sich aus den Fluten der Moldau nicht retten, aber möglicherweise sollte er den Sandhof vor der nahen Passer bewahren. Daneben steht der Brückenheilige auch für Verschwiegenheit und Beichtgeheimnisse – auch dazu hätte die Frau des gefeierten und gejagten Oberkommandanten sicherlich einiges zu erzählen gewusst.
Der wunderliche Wånser Näppermukk macht wundrig: In welchen Bildstöcken, an welchen Wänden, auf welchen Gebrauchsgegenständen in Passeier ist der Heilige mit Kreuz in der Hand (und bisweilen dem Zeigefinger vor dem Mund) noch zu finden? Somit scheint die neue Passeirer Publikation sagen zu wollen: Haltet Ausschau nach „Johannis Näppermukk, der (nit lai) unter der Prugge in Lättn huckt“.
Kennst du Nepomuk-Darstellungen in Passeier? Wir freuen uns, wenn du sie uns zuschickst.
Monika Mader, Werner Graf, Katrin Klotz
s‘ Wonser Kirchl. Die Kirche und die Prozession zum hl. Johannes von Nepomuk in Wans. 1822 – 2022
herausgegeben von Albert Oberprantacher und Wolfram Klotz für den Pfarrgemeinderat Walten
2022, Meran
Das Buch ist u.a. im MuseumPasseier erhältlich.
Ich trage einen großen Namen
Wenn man als bärtiger Hofer-Nachfahre im Hofer-Museum arbeitet.
Für Andreas-Hofer-Dokumentationen ist David Hofer ein Dreier-Jackpot: Bärtiger Hofer-Nachfahre, Historiker und Vermittler im Hofer-Museum. © MuseumPasseier
Fernsehstar wider Willen. Oder: Vom Museum in die Unterhaltungsshows.
Von David Hofer
Meine Mitarbeit im MuseumPasseier begann 2008, ein netter Nebenjob als Ergänzung zum Studium. Mittlerweile 14 Jahre und tatsächlich auch einen Studienabschluss später bin ich immer noch Teil des Museumteams. Erst vor kurzer Zeit gab es eine interne Veränderung und wir Mitarbeiter*innen wurden gebeten uns kurz vorzustellen. Ich erwähnte meine üblichen Arbeitsbereiche im Museum und ergänzte „falls ein Gesicht für Film oder Fernsehen gesucht wird, dann schickt man üblicherweise mich vor“.
Tatsächlich kam es bereits zu drei solcher TV-Produktionen. Natürlich liegt dies nicht nur daran, dass ich im MuseumPasseier arbeite, vielmehr daran, dass ich zusätzlich zu den über 500 lebenden Nachfahr*innen des Andreas Hofers gehöre und bequemerweise im dazugehörigen Museum zu erreichen bin. Dreimal kam bisher also ein Anruf, dass ein Hofer-Verwandter gesucht wird und meine halbherzigen Versuche auf andere Nachfahr*innen zu verweisen, blieben bislang erfolglos.
2017, 250 Jahre nach Hofers Geburt, wurde das Museum wegen eines neuen Dokumentationsfilmes der Reihe Universum History kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, mein kurzes Radiointerview im Gedenkjahr 2009 bliebe der Höhepunkt meiner medialen Präsenz – oder auf Platz 2, immerhin war ich als Grundschulkind vom Rai Sender Bozen zum Suppentag interviewt worden. Universum History war sicherlich die größte der Produktionen, an der ich teilhaben durfte. Viele verschiedene Drehorte, ORF und Arte involviert, einiges an Zeitaufwand. Robert Neumüller, der Regisseur und ein echter Wiener, begleitete mich freundlich und hatte in der gemeinsamen Zeit stets Geduld für meine Laienfragen. Wichtigste Anweisung war dabei, dass ich mir ja nicht den Bart stutzte.
Ich versuchte meine Rolle so gut es ging zu erfüllen. Dargestellt wurde ich als Historiker, was vermutlich in Anbetracht meines Geschichtestudiums innerhalb der Lehramtsausbildung etwas übertrieben war. Aber zum Wohle des Filmes wurde dick aufgetragen. Unter anderem musste ich mit fachmännischem Blick alte Dokumente durchblättern, die ich nicht wirklich entziffern konnte. Paläografie gehörte leider nicht zu meinen besuchten Lehrveranstaltungen. Spätestens als ich diese Einstellung zum dritten Mal wiederholen sollte, sah ich ein, dass Schauspielerei nichts für mich war.
An einem anderen Tag, es war der Herz-Jesu-Sonntag, sollte ich dann den urigen Passeirer mimen. Der Regisseur erkannte aber recht schnell, dass ich in der Rolle nicht wirklich überzeugte, als ich mich beladen mit Fackeln die steilen Hänge in Glaiten hinaufquälte. Die Filmproduktion war für mich insgesamt eine Fortbildung. Ich durfte mich mit vielen Menschen unterhalten, die zu Andreas Hofer forschten und mir neue Inhalte und Perspektiven darstellten. Hier und da versuchte ich in den Gesprächen natürlich etwas „Schleichwerbung“ für das Museum zu platzieren.
Der Bart darf nicht ab. Museumsmitarbeiter David Hofer in seiner Rolle als bärtiger Hofer-Nachfahre und vorzeitig geadelter Historiker in der Folge „Held wider Willen“ von UNIVERSUM HISTORY. (Screenshot des Teasers, ORF2).
Bereits im Jahr darauf, 2018, sollte ich zwei weitere Male vor einer Kamera sitzen. Anders als die große Filmproduktion war es jeweils nur ein kurzer Auftritt. Abermals klingelte das Telefon im Museum und wieder wurde auf mich verwiesen, als die im SWR etablierte Sendung “Ich trage einen großen Namen“ einen Nachfahren des Andreas Hofers suchte. Im Endeffekt handelt es sich dabei um ein „Wer bin ich“-Spiel, wobei Prominente versuchen die Vorfahr*innen mithilfe von Fragen zu erraten. Dafür durfte ich erster Klasse mit dem Zug nach Baden-Baden anreisen, in einem schönen Hotel unterkommen und neben den Anreise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, erhielt ich sogar zusätzlich ein Honorar. Was ich ebenso erhielt, war eine E-Mail nach dem Auftritt. Laut dieser hätte ich im nachfolgenden Gespräch der Show das Heldentum des Andreas Hofers zu wenig herausgehoben. So hatte ich mir meine erste Fanpost nicht vorgestellt.
So ist das, wenn man einen großen Namen trägt. Nach dem Auftritt in der Sendung „Ich trage einen großen Namen“ gab es unerwartet Post für David Hofer. Der SWR fragte: Wo war das Heroische am Hofer geblieben? (Screenshot der Sendung, SWR)
Der letzte Fernsehauftritt war ein spaßiges Gespräch mit Hanno Settele, der in der unterhaltsamen Reihe „Der Kurier des Kaisers“ versuchte herauszufinden, wie viel jedes Bundesland in Österreich wert war. Mit Augenzwinkern wurde ich hierbei in Innsbruck gefragt, wie es mit der Vermarktung des Andreas Hofers aussehen würde. Natürlich gefilmt vor einem HOFER – also der Supermarktkette.
Wie lässt sich heute aus dem Andreas Hofer Geld machen? Hofer-Nachfahre David Hofer wird auf dem Parkplatz vom HOFER für „Der Kurier des Kaisers“ dazu interviewt (Screenshot der Folge vom 18.10.2018, ORF1).
Es waren interessante Erfahrungen, besonders die große Filmproduktion. Andererseits genoss ich den letzten Auftritt wohl am meisten, da er die lockerste Atmosphäre bot und ich allgemein nur einen kleinen Part darin hatte (auch wenn ich erneut als Historiker ausgegeben wurde).
Was am Ende bleibt sind von Zeit zu Zeit keck lachende Bekannte, Freund*innen sowie auch Schüler*innen mit dem darauffolgenden Satz: „Ich habe dich/Sie gestern im Fernsehen gesehen.“
Über die Zulle
Gegen das Ungeziffer: Erzählungen über Maikäferplagen im Passeier.
2024 ist Zullnjoor. © MuseumPasseier
Gegen das Ungeziffer: Erzählungen von Maikäferplagen im Passeier.
Von Elisa Pfitscher.
Recherchen: Annelies Gufler, Judith Schwarz
Der 6. September – ein wichtiger Tag für die Passeirer*innen. An diesem Tag wird an den Heiligen Magnus gedacht, welcher bis heute in vielen Teilen Deutschlands und Österreichs unter der bäuerlichen Bevölkerung als Schutzpatron vor Schäden durch allerlei Getier gilt. Magnus von Füssen, der um das siebte Jahrhundert ursprünglich auf den Namen Maginold getauft wurde, lebte unter Einsiedlern, als Mönch im heutigen St. Gallen. Mit seinem Abtstab soll er Schlangen und Dämonen vertrieben haben, ja sogar einen Drachen soll der Mönch damit überwältigt haben. Magnus bewahrte die Menschen vor Untieren, aber auch vor Kleinlebewesen, wie dem Maikäfer und den Engerlingen, welche die Ernte der Felder zu vernichten drohten.
Recherche im Pfarrarchiv St. Leonhard mit überraschendem Ergebnis: Bis ins Jahr 1833 reicht der “Gomioner Engerlingfeiertag” zurück. © MuseumPasseier
Besonders gedacht wird Magnus in der Fraktion Gomion. Aufzeichnungen aus dem Pfarrarchiv von St. Leonhard bezeugen, dass der Feiertag seit dem Jahre 1833 begangen wird, aus Anlass der vorhergehenden verheerenden Zullen-Jahre. Die Bezeichnung Zulle stammt wohl vom trentinischen Begriff „Zurla“ ab, welcher von trentiner Wald- und Bauarbeitern gebracht wurde. Auch das welschtiroler Wort „Zoria“ kann dabei Pate gestanden sein (Passeirer Blatt, 05/2013). Das Wort „Zurna“ oder „Zurla“ bezeichnet ein ursprünglich osmanisches Musikinstrument, welches ein Oboe-ähnliches Holzblasinstrument ist und dessen charakteristischer Ton aus surrenden und hohen-durchdringenden Lauten besteht. Es könnte somit ein lautmalender Ausdruck für die Geräusche sein, die man an einem heiteren Frühlingsabend unter einem Laubbaum voller Maikäfer vernimmt.
Die Zulle ist seit Menschengedenken ein Übel, welches nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Die Bauern hatten große Sorge um ihre Ernte, denn dieser Blatthornkäfer ernährt sich – wie bereits der Name verrät – von den Blättern der Laubbäume, und dies in einem Ausmaß, dass sogar die Walnüsse im Tal zu einer Rarität wurden. Nüsse waren ein wichtiges Grundlebensmittel und wurden sogar im Gasthaus als Einsatz beim Kartenspielen genutzt. Gab es ein Jahr mit vielen Maikäfern, fand man kaum noch eine einzige Nuss am Baum und so auch nicht am Wirtshaustisch (mündliche Erzählung von Annelies Gufler).
Hintern Huuli gips kuëne Zulln! Dass der Aufruf zum Magnus-Feiertag erfolgreich war, bestätigen teilweise die alten Sprichwörter im Passeiertal. Man kann mehrere Gründe dafür vermuten: Blieben die Gomioner von den Zulln verschont, weil die Ortschaft zu hoch gelegen ist? Oder mochten die Zulln dieses Plätzchen im Passeiertal nicht? Gab es doch vor dem Magnus-Feiertag zum Teil große Schäden auf den Höfen hinter St. Leonhard. Trotz der Erzählungen und Mythen wurde Gomion dennoch nicht verschont.
Eine Katastrophe für eine Bauersfamilie in der Nachkriegszeit. Rosa Hauser (Kourtl Rouse), Jahrgang 1933, erinnert sich, wie schwer es sie und ihre kinderreiche Familie auf dem Hof in Schlattach getroffen hatte. Als sie 12 Jahre alt war, haben Engerlinge alle Wurzeln von Gras und Weide abgefressen. Als der Vater daraufhin mähen wollte, wurde das Ausmaß des Schadens ersichtlich: Der Woosn geat hee, die Grassoden lösten sich, die wenigen Grashalme waren abgedorrt. Der Jahresertrag fiel dementsprechend gering aus und der Boden war zum Teil völlig unfruchtbar.
Eine Lösung gegen ein Ungeziefer, welches kaum Feinde kennt. Der Maikäfer hat mindestens den Dachs, den Marder und den ein oder anderen Vogel – wie etwa den Rotfußfalken im Etschtal, auch Zullenfalke genannt, zu fürchten. Der Engerling hingegen wird nur vom Maulwurf verspeist. Manche Passeirer*innen hofften, dass wenigstens die Hühner diese Viecher fressen möchten, doch diese verzehrten kaum einmal einen zappelnden, zirpenden Maikäfer. Anders die gekochte Variante: Zulln wurden eingesammelt, mit brühend-heißem Wasser übergossen und auf den Mist geworfen, wo viele von ihnen vom Federvieh gefressen wurden.
Nicht nur eine Spezialität für Hennen. Im Pustertal galten die unbeliebten Frühjahrsgäste als Nahrungsmittel und wurden mancherorts zu einer heilsamen und nahrhaften Suppe verkocht, welche nervenstärkend und blutreinigend sein soll. Obwohl sich die Mythen darum ranken, dass das Würzmittel „Maggi“ aus Maikäfern gewonnen wird, kann dies anhand der Recherchen nicht bestätigt werden.
Das Ministero dell´Agricoltura bittet im April 1947 die Ortspfarrer um Unterstützung bei der Maikäferbekämpfung. © Pfarrarchiv St. Leonhard in Passeier
Letztlich müssen sich die Bauern selbst helfen und eine Lösung gegen die Zulln-Plage finden. Und diese bestand vor allem aus dem Einsammeln der Tiere. Die Tatsache, dass eine einzelne Familie gegen die große Plage nicht viel bewirken konnte, erkannten auch die Verbände im Land. Es galt im Kollektiv die Schädlinge zu beseitigen. In den Nachkriegsjahren wurde daher ein Erlass vom Landwirtschaftsinspektorat, in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Gemeinden, veröffentlicht, welcher jede*n der Gemeinden erreichen sollte. Mit Unterstützung des Ortspfarrers wurde auf die Anordnung aufmerksam gemacht, um mit Hilfe aller Bauersleut der betroffenen Gemeinde die wiederkehrende Plage abzuwenden.
Zeitzeuge Adolf Höllrigl während des Interviews über das Zulln-Sammeln in Kuens. © MuseumPasseier
Schritt für Schritt gegen das Ungeziffer. Wie soll die gemeinsame Bekämpfung der Schädlinge erfolgen? In bestimmten Gemeinden wurden Sammelstellen errichtet, an denen – vielfach auch von Kindern – Eimer und Säcke voller Maikäfer hingebracht wurden. Solch eine Sammelstelle gab es auch in Kuens, erzählt der 80-jährige Adolf Höllrigl. Vom Landwirtschaftsinspektorat in Auftrag gegeben, wurden am Tschaupphof in Kuens bis in die 1950er Jahre eingesammelte Zulln abgegeben, gewogen und alle Daten in einem Register vermerkt. Dieser große, zusammengetragene Haufen an Zulln wurde mit siedendem Wasser übergossen und landete abschließend auf dem Misthaufen, wo er zum Teil von den Hühnern verspeist wurde.
Der Tschaupphof in Kuens war bis in die 1950er Jahre offizielle Zulln-Sammelstelle. © Adolf Höllrigl
Das Unterfangen, so viele Zulln wie möglich einzufangen, bedarf weniger Geschick als Ausdauer. Wichtig war nur, früh genug dran zu sein, da die Käfer am Tage ausfliegen. In der Finsternis hängen sie an den Bäumen und Blättern und fressen all das ab, was sie unter die Fühler bekommen. Am frühen Morgen ging es zu den Laubbäumen und den Weinreben. Diese wurden alle einzeln geschüttelt, um – mithilfe eines darunterliegenden Leintuchs – die benommenen und trägen Zulln rasch einzusammeln. Adolf Höllrigl erzählt aus seiner Jugend und über den Versuch der Einschränkung der Maikäfer-Plage in seiner Heimatgemeinde Kuens:
Die Gegenwart zeugt von den Ereignissen der Vergangenheit. Viele Erzählungen erinnern an die Gefahr von früher, da die Existenz ganzer Familien von den Zulln und Engerlingen bedroht war. Man erbat die Hilfe des Heiligen Magnus, setzte auf die geistliche Unterstützung im Kampf gegen die „Strafe Gottes“ oder verfolgte die Käfer, auch in Folge einer behördlichen Anordnung. Jene Kinder, welche bei der Maiandacht noch ein Exemplar dieses Tierchens – surrend und kletternd – in der Kirche fliegen ließen, machten sich aus dem Streich – im Gegenteil zu den restlichen Kirchgängern – einen großen Spaß (mündliche Erzählung von Konrad und Eberhard Pfitscher aus St. Leonhard).
Die Chemie brachte schließlich Abhilfe, aber nicht nur gegen den Feind. Die Gefahr einer Zulln-Plage ist seit dem Ende der 1950er Jahren sehr viel geringer geworden, da die Obstbäume mit immer mehr Pestiziden und Pflanzenschutzmittel gespritzt werden. Dies jedoch zum Leid aller Insekten, auch deren, welche so nützlich für ein ausgeglichenes Ökosystem sind. Der Preis ist hoch für eine Gegend ohne Zulln.
Die Spitalfrage
Warum Passeier kein Krankenhaus hat.
Die Zusage aus der Kanzlei des Erzherzog Eugen im Pfarrarchiv St. Leonhard: Für ein Andreas-Hofer-Hospital in St. Leonhard gibt es 20.000 Kronen. © MuseumPasseier
St. Leonhard kämpfte vor 113 Jahren für das Andreas-Hofer-Hospital.
Warum es nur bei der Planung geblieben ist.
Von Jasmin Angler
„Der Bezirk Passeier steht bezüglich Krankenpflege noch weit hinter der gewöhnlichen Kulturstufe zurück.“ So ernst ist die Lage also, als sich am 13. Februar 1909 die Passeirer Gemeindevertreter an Erzherzog Eugen (1863-1954) in Wien wenden. In ihrem Brief machen sie die dürftige pflegetechnische Versorgung des Tales deutlich und weisen darauf hin, dass es in den eigenständigen Gemeinden Moos, Platt und Rabenstein keine Einrichtung für kranke Menschen gibt.
Was geschieht also mit kranken Personen im Hinterpasseier? Werden sie in die Ferne geschickt, um dort medizinisch versorgt und gepflegt zu werden? Oder wird aus der Ferne jemand zu ihnen geschickt, um sich mit der kranken Person auszutauschen und medizinische Dienste zu leisten? Vor 113 Jahren müssen sich oftmals Kranke, Schwache und Hilfesuchende im Hinterpasseier von Haus zu Haus betteln. Und hoffen, im Austausch mit einer kleinen Gegenleistung aufgenommen zu werden.
Dies kann keine Dauerlösung bleiben. Das betonen die Gemeindevertreter in ihrem Schreiben an den Erzherzog: „Diese gezwungene Krankensorge bringt sowohl für die Sorge des Leibes als auch der Seele viel Unpassendes, Missliebiges und Menschenunwürdiges.“ Die Vertreter sind sich einig, dass diese Notlage Hilfe von außen erfordert. Der Pflegemangel ist so schlimm, dass kränkliche Personen oft den Winter in Scheunen verbringen müssen.
„Ein ungeregeltes Armenwesen bürgt Gefahren für Gesundheit, Religion und Sittlichkeit.“ Mit diesen Worten soll das Schreiben nach Wien die Zustände jener Zeit vor Augen führen. Es wird auch beschrieben, dass es in St. Leonhard eine Einrichtung für Kranke gibt. Diese wird sogar als “gegenwärtiges Krankenhaus” bezeichnet.
Warum ist die Lage dennoch so schlimm wie sie ist? Das damalige Gebäude für die Krankenversorgung ist kein Krankenhaus im heutigen Sinne, sondern eine kleine soziale Einrichtung, in der Arme und Kranke untergebracht werden. Es wird zu dieser Zeit Armenhaus genannt und befindet sich auf der Stickl oberhalb des Dorfzentrums St. Leonhard (heute Platzlhaus, Gerichtsweg). In den Wintermonaten ist der Weg dorthin eisig, rutschig und schneebedeckt und für die Patient*innen unmöglich begehbar. Der Besuch der Heiligen Messe ist also ausgeschlossen. Und somit ihr einziger Trost.
Die ungünstige Lage ist nicht das einzige Problem. Aufgrund von Platz- und Personalmangel werden nur maximal 15 Hilfesuchende aufgenommen, die von einer (!) Frau versorgt und gepflegt werden. Die Geschichte des Armenhauses in der Stickl startet schon am 19. Februar 1841. Ein anonymer Spender schenkt das Platzlhaus dem hiesigen Dekan. Der Geistliche, Alois Stuefer (1802–1888), legt nun die Grundlagen des späteren Armenhauses: Er beherbergt im kleinen Haus kranke Menschen aus der Pfarre. Die Nachfrage ist so groß, dass die Einrichtung um einen Stock erweitert wird.
Dann tritt Alois Stuefer das Armenhaus ab. Am 24. August 1844 überträgt der Dekan die Einrichtung dem Lokalarmenfonds. Dieser wird durch die Armenkommission vertreten, genauso wie von der Gemeindevorstehung. Später, im November 1894, bestimmt die Gemeinde im Armenhaus zusätzlich ein Arrestlokal zu erbauen.
Wir spulen wieder nach vorne. Und zwar zur dürftigen Pflegesituation in Passeier 1909. Wie reagiert Erzherzog Eugen auf das Schreiben der Gemeindevertreter vom Februar? Am 15. Juni antwortet Kanzler Moritz von Weittenhiller (1847–1911): „(…) daß seine k. und k. Hoheit der Hochwürdigst-Durchlauchtigste Herr Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Eugen das Gesuch der fünf Gemeinden St. Leonhard, St. Martin, Platt, Moos und Rabenstein (…) betreffend die Errichtung des Andreas-Hofer-Hospitales in St. Leonhard mit dem gnädigsten Wohlwollen zur Höchsten Kenntnis genommen haben und (…) gerne bereiterklären (…) dieses Werk der Nächstenliebe und des Patriotismus (…) zu unterstützen und zu fördern.“
Doch dem Kanzler ist alles noch zu ungenau. Um mit der Planung fortzufahren, bedarf es weiterer Details. So fragt der Kanzler, wer alles im sogenannten Andreas-Hofer-Hospital untergebracht werden soll: Steht es Kranken und auch Pfründnern zur Verfügung? Pfründner können sich zu jener Zeit mit Geld in ein Krankenhaus einkaufen. Sie sind alleinstehend, haben aber die nötigen finanziellen Mittel.
Außerdem will der Kanzler die Geschlechteraufteilung klären: Wie viele Pfründner und Pfründnerinnen, wie viele kranke Männer und wie viele kranke Frauen sollen aufgenommen werden? Das Festhalten dieser Details ist nötig, um aufgrund der geplanten Maximalbesetzung das Personal anzupassen. Auch wo das neue Andreas-Hofer-Spital stehen soll, will der Kanzler wissen. Als letzte Unklarheit wird die finanzielle Frage genannt: Bevor kein genauer Budgetplan mit Kostenvoranschlag eingereicht wird, kann keine Subvention bestimmt werden.
Wo in St. Leonhard sollte das Hospital überhaupt sein? Helge Adler (1919–1989) hält Folgendes für uns fest: „Im Jahre 1909 stand das Brühwirtshaus zum Verkauf. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden um den Neubau eines Krankenhauses für die ganze Gerichtsgemeinde Passeier, also alle Talgemeinden, zu erwirken.“ Helge Adler, geboren in Norddeutschland und mitsamt seiner Familie nach St. Leonhard ausgewandert, ordnete jahrelang das Gemeindearchiv von St. Leonhard. Seine Tochter, Susan Adler, war beruflich als Krankenschwester tätig. Krankenschwester – Krankenhaus: Aus Liebe zu seiner Tochter muss er sich für den geplanten Bau des Andreas-Hofer-Hospitals interessiert haben.
Nach weiterem Austausch der Gemeindevertretungen mit Wien kommt die Zusage vom Sponsoring schriftlich und mit Stempel. Am 22. Dezember 1909 bestätigt der Kanzler dem Vorsteher der Gemeinde in St. Leonhard, Alois Haller: Das Brühwirtshaus kann laut Budgetplan angekauft werden, um dort das Andreas-Hofer-Hospital umzusetzen. Auch der Gemeindearzt von St. Leonhard, Dr. Neurauter, bestätigt das Brühwirtshaus als geeigneten Ort.
Was kann jetzt noch dazwischen kommen? Oder besser gefragt: Wer? In der Recherche von Helge Adler lesen wir, dass die Gemeinde St. Martin dem Projekt nur unter gewissen Bedingungen zustimmt. Eine Bedingung ist, dass die Gemeinde St. Martin automatisch drei Freiplätze bekommt. Wenn dies nicht möglich ist, will man eine finanzielle Entschädigung haben.
Heute gibt es kein Krankenhaus in Passeier. Wieso nicht? Am 3. April 1910 wird vom Gemeinde-Ausschuss St. Martin Folgendes beschlossen: Der geplante Kauf des Brühwirtshauses in St. Leonhard wird nicht anerkannt. Auch Helge Adler fragt sich: „Was war geschehen? Am 22. März 1910 war der Gemeindevorsteher von St. Martin vor dem Landesausschuss in Innsbruck erschienen (…), wobei von S(t). M(artin) gegen den Kauf Einspruch erhoben wurde. Wegen der Dringlichkeit des Vorkaufs hatte der Bürgermeister von St. Leonhard (…) das Brühwirtshaus auf eigene Rechnung bereits gekauft.” Weitere Argumente waren, dass die Kosten mittlerweile erheblich höher ausfielen, dass St. Martin nicht eingebunden worden war bzw. dem dortigen Gemeindeausschuss erklärt worden ist, er hätte “nicht drein zu reden” und St. Martin “glaubte (…) großen Schaden zu erleiden”, wenn wegen des Hospitals das Gerichts-Bruderhaus in St. Martin aufgelöst würde. In St. Martin bestand nämlich, ebenso wie in St. Leonhard, ein Armenhaus und zusätzlich für das Gericht Passeier ein sogenanntes Bruderhaus. Beide in ähnlich kümmerlichem Zustand wie das Armenhaus in St. Leonhard.
Somit kommt das Andreas-Hofer-Hospital – trotz Sponsorenzusage – nicht zu Stande. Die Spitalfrage endet hiermit. Was bleibt, ist der Gedanke: Stellen wir uns vor, dass im Brühwirt, wo heute Gäste bewirtet werden, genausogut Krankenhauspatient*innen behandelt und gepflegt werden könnten.